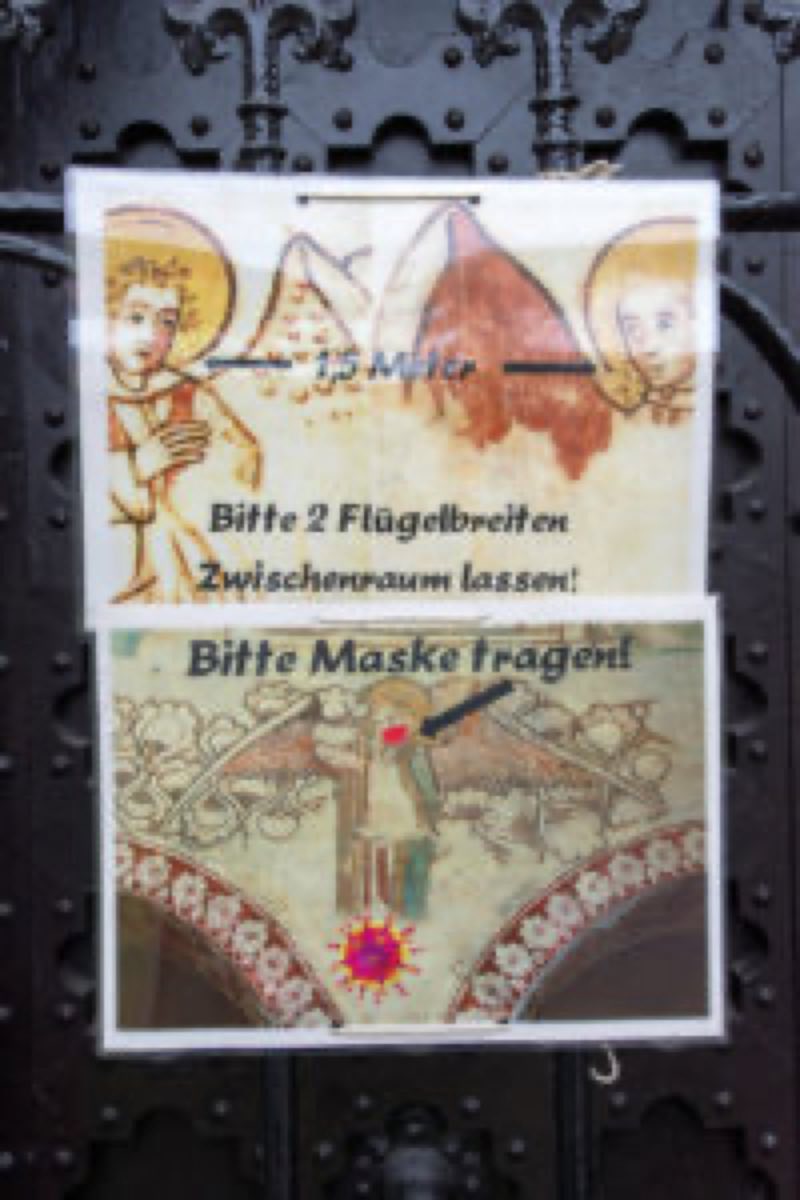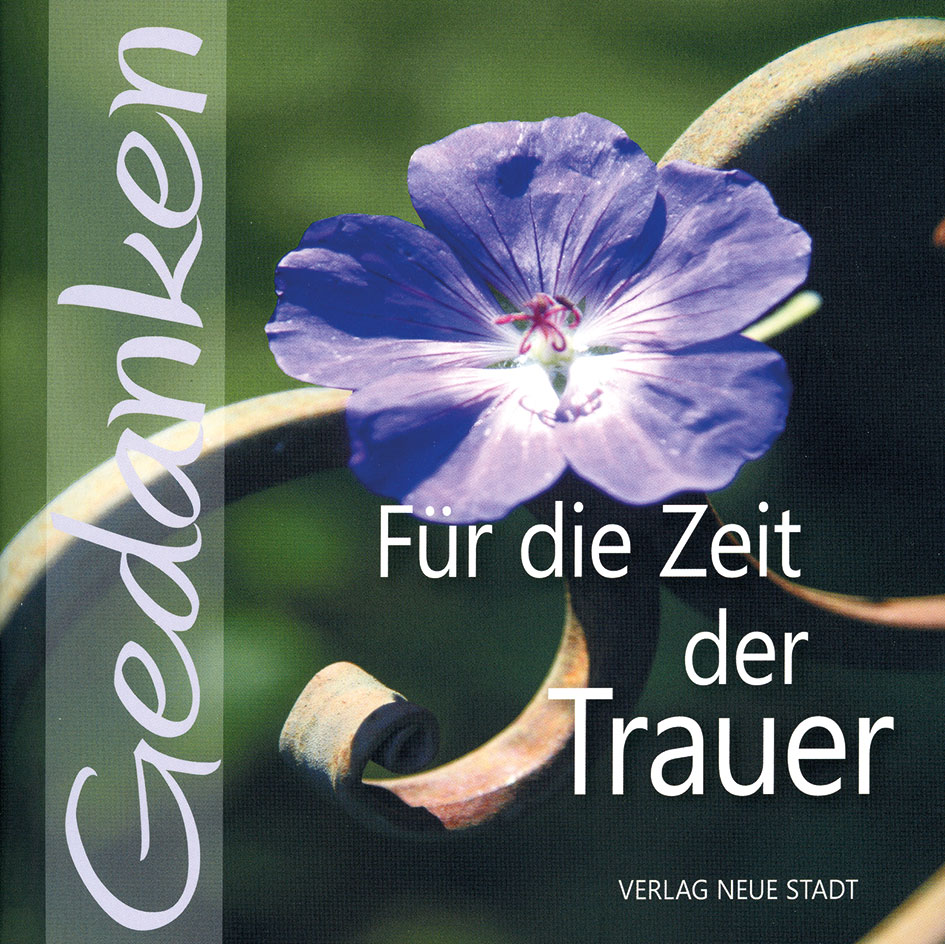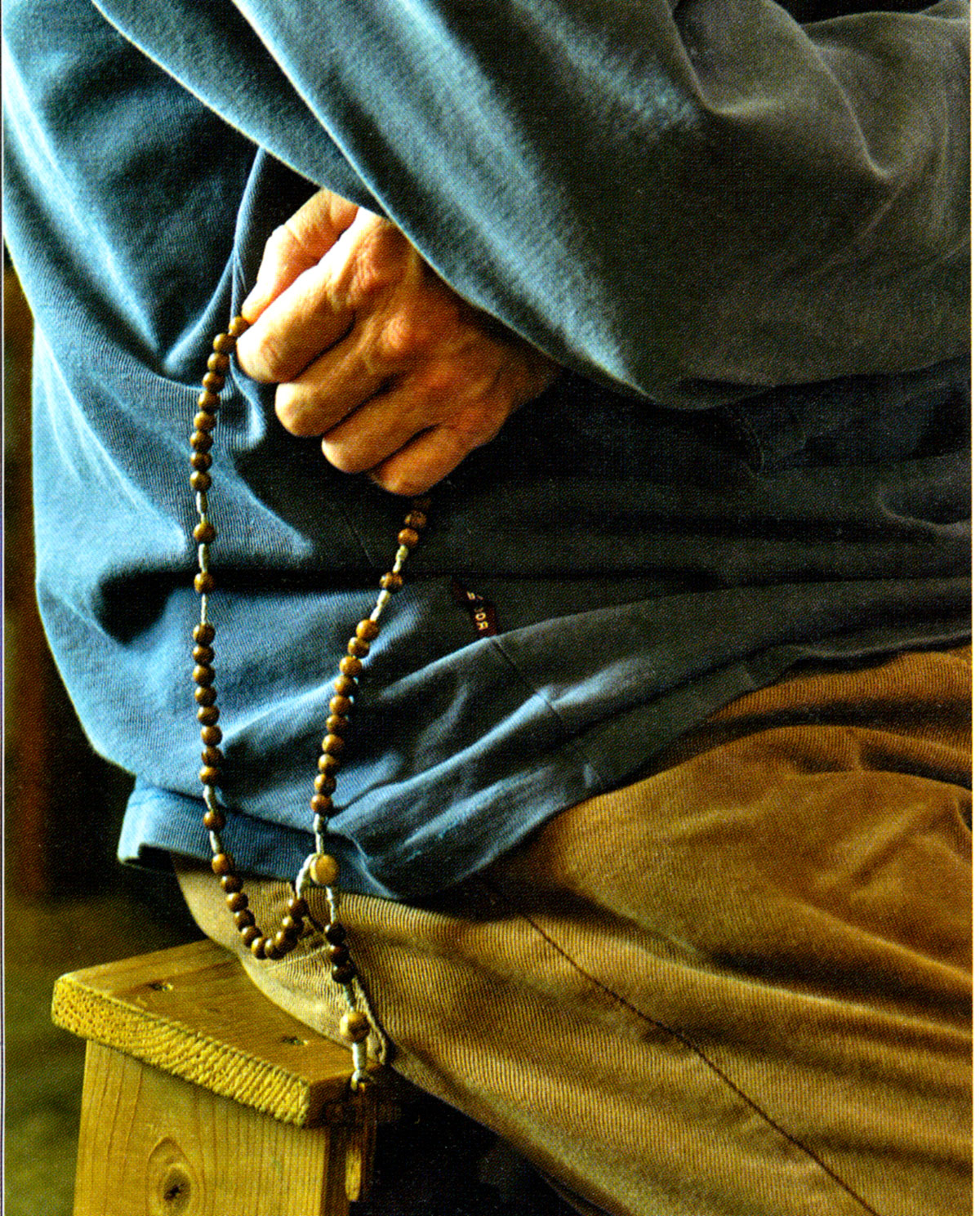Wie werden wir im Neuen Jahr unser Leben gestalten? (Foto: Poss)
Das Coronavirus verfolgte uns im vergangenen Jahr und es stellte unsere Vorstellungen von einem Leben in Gesundheit, Freude und Wohlstand infrage. Hätte vor einem Jahr jemand gesagt, dass wir während eines Grossteils des Jahres 2020 mit einer Maske herumlaufen und nicht nur während ein paar Tagen in der Fastnachtszeit – man hätte ihn ausgelacht und als verschrobenen Propheten des Weltuntergangs abgestempelt und in irgendeine Anstalt abgeschoben.
Gemeinsam oder gar nicht
Und doch hat dieses kleine, für das menschliche Auge unsichtbare Virus es geschafft, dass wir unseren Lebensstil hinterfragen und ändern mussten, ob wir das wollten oder nicht – es musste sein. Die Corona-Pandemie hat uns «kalt erwischt», denn wohl niemand von uns war wirklich auf so ein Szenario vorbereitet. Wir lebten, als ob uns nichts passieren könnte, wir missbrauchten Menschen und Umwelt, wir zerstörten unsere Natur und vergassen, dass es eine Illusion ist zu meinen, wir könnten in einer kranken Welt gesund bleiben. Die Augen sind vielen von uns aufgegangen, dass wir Menschen mit unserer unstillbaren Sucht nach immer mehr, schneller und höher, am meisten uns selbst an Leib und Seele geschadet haben. Papst Franziskus nennt dies in seiner neuesten Enzyklika «Fratelli tutti» eine trügerische Illusion, die glaubt, dass wir allmächtig sind, und dabei vergisst, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Um diese Not zu wenden, ist es unumgänglich, zu erkennen, dass «wir die Probleme unserer Zeit nur gemeinsam oder gar nicht bewältigen werden». Der Papst setzt Solidarität gegen Egoismus – auch im Falle der Pandemie, die für den Heiligen Vater keine Strafe Gottes ist, sondern «die Wirklichkeit selbst, die seufzt und sich auflehnt». Dieses Seufzen gilt es ernst zu nehmen und daraus Konsequenzen zu ziehen, die aus dem Seufzen von Menschen und Natur ein Aufatmen werden lässt in einer Welt, in der es für alle Platz hat, eine Welt, in der alle einander als Brüder und Schwestern begegnen. Dazu gehört, nach der Vorstellung des heiligen Franz von Assisi auch die Schöpfung. Werden wir aber aus der Geschichte lernen, oder wird es auch diesmal wiederum so sein, dass wir schlechte Schüler und Schülerinnen der Geschichte sind? Das «Rette sich wer kann» würde dann zu einem «Alle gegen alle» – «und das wird schlimmer als eine Pandemie sein», so der Papst in seinem Schreiben.

Was ihr von den anderen erwartet, das tut auch ihnen. Skulptur von Thomas Hürner. Foto Poss
Für die Liebe geschaffen
Vielleicht sollten wir uns immer wieder vor Augen halten, was Papst Franziskus in «Fratelli tutti» schrieb: «Wir sind für die Liebe geschaffen!» Diese Liebe kennt drei Richtungen: Zu mir selbst, zum Mitmenschen, zu Gott. Schauen wir uns diese Richtungen ein wenig näher an.
Selbstliebe ist etwas ganz anderes als Egoismus. Dieser denkt nur an sein Wohlsein und sein Vorwärtskommen. Dafür ist er bereit alles zu opfern und selbst über Leichen zu gehen. Selbstliebe beginnt, indem ich mich und mein Leben so annehme wie ich bin und wie es ist. Gott hat mich erschaffen in meine ganz konkrete Existenz hinein. Er hat mir mein Leben geschenkt mit allen Verheissungen und Bedrohungen, mit meinem Stolz und mit meiner Lächerlichkeit, mit all meiner Intelligenz und mit meinen Grenzen und meinem Versagen. Aber auch mit meinen Träumen von Ehre, Schönheit, erfülltem Leben, menschlicher Nähe, Freundschaft und Liebe. All dies hat mir die Gnade Gottes geschenkt. Durch mein Leben wird der Wille Gottes für mich ersichtlich. Darum ist kein Ereignis in meinem Leben gleichgültig oder neutral. Jede Existenz ist würdig, so wie sie ist, weil sie die Liebe und Freundschaft Gottes zu jedem einzelnen Menschen sichtbar werden lässt. Die Bibel drückt das aus, indem sie deutlich macht, dass jeder Mensch Abbild Gottes ist (vgl. Gen 1, 26). Liebe zu sich selbst will letztlich dazu führen, dass der Mensch das aus sich selber macht, was er nach dem Willen Gottes sein soll: frei, glücklich, offen für andere, fähig, Gott und die Menschen zu lieben. Ohne diese Liebe zu sich selbst kann das Leben nicht gelingen. Deshalb: «Sei gut und lieb zu dir. Sei gnädig mit dir, selbst dann, wenn du versagt hast und immer wieder an deine Grenzen rennst. Gott hält unendlich viel von dir; deshalb darfst auch dir etwas zutrauen. Nimm dich jedoch nicht zu wichtig; begegne dir vielmehr mit Humor und Gelassenheit».
Sorge tragen zur Gesundheit
Im Blick auf die Corona-Pandamie kann Selbstliebe auch heissen, zu seiner eigenen Gesundheit Sorge tragen. Gott hat uns Menschen mit Leib und Seele geschaffen und als solche sind wir seine Abbilder. Deshalb müssen wir zu Leib und Seele Sorge tragen, ohne unseren Leib zu vergötzen, aber auch ohne ihn zu verachten, denn er ist uns als gottgeschenktes Gut anvertraut. Es war in den vergangenen Monaten immer wieder die Rede von Menschen, die gegen die vom Staat angeordneten Schutzmassnahmen protestierten und die Hygienemassnahmen nicht respektierten und auch keine Maske trugen. Andere wiederum wagten sich kaum noch auf die Strasse, schlossen sich angstvoll in ihren vier Wänden ein und verfielen dadurch oft in eine Depression. Beide Richtungen sind falsch! Jene, die meinen, ihnen könne nichts passieren, irren sich ebenso wie jene, die meinen, ihnen würde immer alles passieren. Es gilt auch hier, sich an die Vorschriften zu halten, jedoch ohne Angst, denn diese war schon immer ein schlechter Ratgeber. Wir dürfen darauf vertrauen, dass alles, was existiert, von Gott erschaffen worden ist und es war am Anfang sehr gut. «Das, wonach jedes Menschenherz sich bewusst oder unbewusst sehnt, wird von der Heiligen Schrift aufgegriffen, bestätigt und vertieft: Ja, unsere Welt kommt aus einer guten Quelle. Sie ist ein Projekt der Liebe. Und was immer uns widerfährt, letztlich liegt unser Leben in guten Händen. Das Widersinnige, Destruktive und Böse – kein Mensch kann ergründen, warum es geschehen darf – mag sich mächtig gebärden, aber es wird das, was wahrhaft gut und schön ist, nie ganz zerstören können!», schrieb Karl Veitschegger. Und der Apostel Paulus fasst zusammen: «Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt» (Römer 8, 28).

Foto: Poss
Mit den Augen Gottes sehen
Aus der Selbstliebe erwächst die Nächstenliebe! Nur wer sich selbst liebt, sich nicht als Mittelpunkt der Welt sieht, sich selbst riechen kann, kann dann auch den Mitmenschen lieben, denn: «Wer sich selbst nicht riechen kann, stinkt auch dem Anderen» (Bischof Franz Kamphaus). Was aber heisst eigentlich «Nächstenliebe»? Eine Antwort auf diese Frage ist gar nicht so einfach, obwohl verschiedene Suchmaschinen ganz unterschiedliche Definitionen bringen, die mehr oder weniger sinnvoll sind. Eine gute Definition ist wohl, dass die Nächstenliebe der Versuch ist, jeden Menschen mit den Augen Gottes zu sehen. Dazu muss man nicht gleich mit jedem Menschen «allerbeste Freunde» sein, aber wir sollen erkennen, dass jeder Mensch von Gott gewollt und geliebt ist und zwar mit all seinen Charakterstärken, aber auch mit seinen Schwächen. Dadurch kann es gelingen, jedem mit Respekt und einer richtig verstandenen Toleranz zu begegnen. Dem Gebot der Nächstenliebe werden wir nicht gerecht, solange ein Mensch in unserer Umgebung sa–gen muss: «Ich habe keinen Menschen!» Ladislaus Boros schrieb: «Die ganze Lebenshaltung des Christen wäre demnach: Tue das, was niemand an deiner Stelle tun kann und tun wird; halte dich bereit; entwickle in dir eine grundsätzliche Offenheit des Herzens; sei aufgeschlossen allem Leid gegenüber». Die Corona-Pandemie hat viele Menschen in körperliches und psychisches Elend gestürzt. Manchen von ihnen wäre geholfen, würden wir ihnen stärker unsere Liebe und Sympathie bezeugen. Das würde nicht einmal etwas kosten, wäre aber nicht umsonst: Ein frohes Gesicht machen, mit anderen freundlich umgehen, zuhören, mit ihnen lachen und weinen, Zeit für sie aufbringen, den Passanten auf der Strasse grüssen, Hilfe anbieten. Es gäbe noch mehr und jeder mit wachen Augen kann diese Liste weiterführen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott bei allem Guten, das wir tun oder wenigstens zu tun versuchen, hinter uns steht und uns dabei hilft.
Gott im Menschen lieben
An erster Stelle des wichtigsten Gebotes der Bibel steht die Gottesliebe. Wie aber geht das: Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit meinem ganzen Denken? Dr. Johannes B. Brantschen, mein liebenswerter Dogmatikprofessor in Freiburg schrieb in seinem Büchlein «Gott ist grösser als unser Herz», dass wir Gott lieben, wenn wir unseren Bruder, unsere Schwester lieben. «Wer sagt, er liebe Gott und seinen Bruder hasst, der ist ein Lügner, steht im Neuen Testament. Gott will im Menschen geliebt werden! Aber Nächstenliebe, ohne Kompromisse praktiziert, führt in der Welt, wie sie nun mal ist, ins Leiden. […] Wer sich ohne zu mogeln auf das so einfache Gebot der Nächstenliebe einlässt, der gerät unweigerlich in Not und ins Leiden. In der Welt muss man mogeln können, mit den Wölfen heulen können – dann bringt man’s zu etwas: denn Lügen haben lange Beine und unrecht Gut gedeiht prächtig. […] War Jesus naiv, wenn er Nächstenliebe forderte? Keineswegs, sondern Jesus wusste, dass sein Vater noch andere Hände hat als die unseren, und so kann Jesus allen, die wegen praktizierter Nächstenliebe in Not und Leiden geraten, zurufen: “Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden” (Mt 5, 10 und 6). Mein Vater, meint Jesus, wird der Liebe und der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen, denn mein Vater hat Freude an der Liebe, Freude an der Gerechtigkeit. Allerdings: damit Gott die Macht der Liebe, unsere oft mit Füssen getretene Liebe vollenden kann, muss sie hier und heute anfangen. Den Rest wird Gott besorgen. Das hat Jesus gemeint!»

Foto: Poss
Wenn wir durch die Corona-Pandemie wiederum gelernt haben, das Gebot der Gottesliebe, der Nächstenliebe und der Selbstliebe besser im Alltag umzusetzen, dann hat dieser unappetitliche Virus vielleicht doch noch etwas Gutes gebracht, wenn auch zu einem sehr hohen Preis.
Packen wir diese Chance und wählen wir eine Lebensgestaltung, die durchdrungen ist von der Liebe. «Wir werden in der Tat zu dem, was wir wählen, im Guten wie im Schlechten. Wenn wir uns entscheiden zu stehlen, werden wir zu Dieben, wenn wir uns entscheiden, an uns selbst zu denken, werden wir egoistisch, wenn wir uns entscheiden, Stunden mit dem Handy zu verbringen, werden wir abhängig. Aber wenn wir uns für Gott entscheiden, werden wir jeden Tag mehr geliebt, und wenn wir uns für die Liebe entscheiden, werden wir glücklich», so Papst Franziskus in seiner Predigt am Christkönigssonntag 2020.
Dieses Glück wünsche ich allen Leserinnen und Lesern an jedem Tag in diesem Neuen Jahr. Paul Martone