
Februar 2024: «Mache Fragezeichen – und doch!»



Das vergangene Jahr
Wieder vorübergegangen ist ein Jahr, und ich bin noch.
Dir, o himmlischer Vater, sei Lob, Dank und Preis für alle Gaben und Wohltaten,
die ich im Laufe dieses Jahres aus deiner väterlichen Hand empfangen habe.
Ein Jahr sagt es dem anderen, wie voll der Liebe und Milde unser Gott ist
und wie unendlich reich deine Erbarmungen und Segnungen sind.
Johann Michael Sailer (1751–1832)

Segen für das neue Jahr
Das neue Jahr, Herr, hat nun angefangen.
Segne mich in allem, was kommt.
Voller Dank für eine Gegenwart sei die Zeit, die du mir schenken willst.
Segne meine Augen, Gott, damit ich dich lobe für das, was sie sehen.
Ich will segnen meine Nachbarn, und ihr Segen möge mir gelten.
Gib mir ein offenes Herz und Hände, die teilen, und mache mich zu einem Segen
in deinem Namen. Amen
Aus Irland
Gebete aus dem empfehlenswerten Buch «Das grosse Buch der Gebete für alle Anlässe»
zusammengestellt von Reinhard Abeln. Erschienen im benno-Verlag.

Woher stammt das Wort «Ökumene»?
Das Wort Ökumene stammt aus dem Griechischen und meint ursprünglich «die bewohnte Erde». Als sich das Christentum immer mehr ausbreitete, wurde dieser Begriff gedeutet als «zur Kirche als Ganzer gehörig».
Und was ist heute damit gemeint?
Ökumene wird heute verstanden als Bemühungen um die Einheit der getrennten Christenheit. Das 2. Vatikanische Konzil sah in diesem Bemühen eine seiner Hauptaufgaben, und die Konzilsväter gaben dies den katholischen Gläubigen als bleibende Aufgabe.
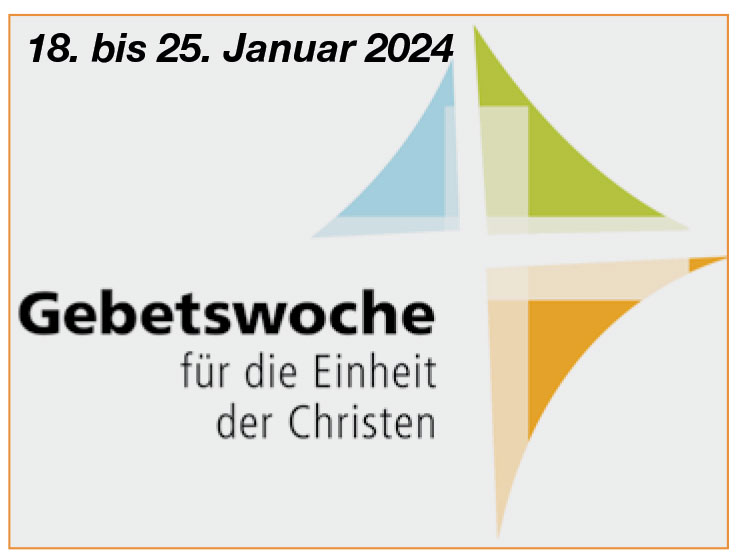
Von einer Einheit aller Christen sind wir aber noch weit entfernt!
Ja, leider herrscht auch heute noch keine Einheit unter den Christen, obwohl schon Jesus betete, dass alle eins seien. Man darf aber sagen, dass es in den vergangenen 70 Jahren doch schon einige Fortschritte auf diesem Gebiet gegeben hat, selbst wenn es immer wieder Fragen gibt, bei denen bislang noch keine Übereinstimmung erzielt werden konnte. Es gab Gespräche zwischen den Kirchen, man fand Wege, um gemeinsam zu beten und Gottesdienste zu halten und noch viel mehr. Dennoch ist es noch ein weiter Weg bis zu einer Einheit der Christen.
Wird das aber nicht ein langweiliger «Einheitsbrei»?
Einheit heisst nicht Uniformität. Es geht eher in Richtung einer Einheit in der Vielfalt. Kardinal Kurt Koch umschrieb das so: «Wir müssen uns nicht in allem einig sein. Wir müssen vielmehr erkennen, dass wir denselben Glauben nur auf unterschiedliche Weise ausdrücken» und Papst Franziskus meinte auf seiner Reise in die Mongolei: «Die religiösen Traditionen stellen in ihrer Originalität und Verschiedenheit ein grossartiges Potenzial an Gutem im Dienste der Gesellschaft dar.»
Besten Dank für die Auskunft. pam

Alle 25 Jahre feiert die katholische Kirche ein Heiliges Jahr. Der Rhythmus von 25 Jahren besteht seit 1470. Zwischendurch gibt es hin und wieder ein ausserordentliches Heiliges Jahr. Das nächste reguläre findet 2025 statt – und soll die Armen und Geflüchteten in den Blick nehmen. Das exakte Datum für die Eröffnung im Dezember 2024 steht noch nicht fest. Es wird mit einer sogenannten Päpstlichen Bulle am kommenden 9. Mai bekannt gegeben.
Pilger der Hoffnung
Papst Franziskus schreibt zum Heiligen Jahr, dass die Coronapandemie uns die Vergänglichkeit der Existenz vor Augen geführt und auch unsere Lebensweise verändert hat, die auch die Christen getroffen hat. «Unsere Kirchen blieben geschlossen, ebenso wie Schulen, Fabriken, Büros, Geschäfte und Freizeiteinrichtungen. Wir alle haben erlebt, dass einige Freiheiten eingeschränkt wurden», was neben dem Schmerz manchmal auch Zweifel, Angst und Verwirrung in den Herzen geweckt habe. Zahlreiche Diskussionen über Sinn oder Unsinn der Schutzmassnahmen und Impfungen wurden geführt, oft in einer Art und Weise, die zu einer Spaltung in Familien und Gemeinden geführt hat. «Das bevorstehende Jubiläum kann viel dazu beitragen, ein Klima der Hoffnung und des Vertrauens wiederherzustellen, als Zeichen eines neuen Aufbruchs, dessen Dringlichkeit wir alle spüren. Aus diesem Grund habe ich das Motto “Pilger der Hoffnung” gewählt», so Papst Franziskus. Diese Hoffnung können wir jedoch nur ermöglichen, «wenn wir unsere Augen nicht vor dem Drama der grassierenden Armut verschliessen, die Millionen von Männern, Frauen, Jugendlichen und Kindern an einem menschenwürdigen Leben hindert. Ich denke besonders an die vielen Flüchtlinge, die gezwungen sind, ihr Land zu verlassen. Mögen die Stimmen der Armen in dieser Zeit der Vorbereitung auf das Jubiläum gehört werden.»

Neben der spirituellen Dimension soll das Heilige Jahr aber auch dazu beitragen, dass wir Menschen als die «Pilger auf der Erde» auf diesem Weg die Schönheit der Schöpfung bewundern und uns um unser gemeinsames Zuhause kümmern. «Ich hoffe, dass auch das naheliegende Jubiläumsjahr in diesem Sinne gefeiert und gelebt wird. Tatsächlich erkennen immer mehr Menschen, darunter viele Jugendliche und junge Menschen, dass die Sorge um die Schöpfung ein wesentlicher Ausdruck des Glaubens an Gott und des Gehorsams gegenüber seinem Willen ist», so der Papst.
«Symphonie» von Gebeten
Es ist der Wunsch des Papstes, dass «das Heilige Jahr mit tiefem Glauben, lebendiger Hoffnung und aktiver Nächstenliebe vorbereitet und begangen werden kann». Daher ruft der Heilige Vater das dem Jubiläum vorausgehende Jahr 2024 zum Jahr des Gebets aus, das «einer grossen “Symphonie” von Gebeten gewidmet» sein soll. «Vor allem, um die Sehnsucht wiederzufinden, in der Gegenwart des Herrn zu verbleiben, ihm zuzuhören und ihn anzubeten; Gebet, um Gott für die vielen Gaben seiner Liebe zu uns zu danken und sein Werk in der Schöpfung zu preisen, das jeden zu Achtung und konkretem und verantwortungsvollem Handeln zu ihrer Bewahrung verpflichtet… Kurzum, ein intensives Jahr des Gebets, in dem sich die Herzen öffnen sollen, um die Fülle der Gnade zu empfangen und das “Vater unser”, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, zum Lebensprogramm all seiner Jüngerinnen und Jünger zu machen.» gv
Zur Vorbereitung des Jubiläums sind die Diözesen aufgefordert, die zentrale Bedeutung des persönlichen und gemeinschaftlichen Gebets zu fördern. Zu diesem Zweck könnten «Gebetswallfahrten» auf das Heilige Jahr hin vorgeschlagen werden, also Wege der Schule des Gebets mit monatlichen oder wöchentlichen Etappen, die von den Bischöfen geleitet werden und an denen das gesamte Volk Gottes teilhaben kann.

Das Vaterunser
Beten kann man auf ganz verschiedene Art. Es gibt das Gebet in der Gemeinschaft der Gottesdienste, es gibt das Gebet in der Familie, es gibt das stille persönliche Gebet jedes Einzelnen, es gibt das Wallfahren, also das «Gebet mit den Füssen», es gibt das Rosenkranzgebet, die Meditation und noch unzählige weitere Formen. Entscheidend ist nicht die Art und Weise, wie jemand betet, wichtig ist, dass er und sie regelmässig betet. Wer betet, sieht weiter, er lebt nicht mehr aus sich, für sich und aus seiner eigenen Kraft, sondern er vertraut sich mehr und mehr Gott an. Die Heilige Mutter Teresa sagte einmal: «Weil ich mich nicht auf mich selber verlassen kann, verlasse ich mich auf Gott, 24 Stunden am Tag.»

Zum christlichen Leben gehört das «Bemühen um das tägliche Gebet. Beten kann man allerdings nicht lernen, wie man eine Technik lernt. Beten ist, so merkwürdig es klingt, ein Geschenk, das man durch Beten erhält» (youcat, Nr. 469). Das Neue Testament berichtet, dass die Jünger Jesus um Rat gefragt haben, wie sie in rechter Weise beten sollten. Jesus beantwortet ihre Bitte mit dem Vaterunser. Deshalb ist das Vaterunser das wichtigste christliche Gebet, das wir jeden Tag beten sollten.
Unkompliziertes Beten
Beim Beten können wir nichts falsch machen! Um mit Gott zu reden, der ja unser «Abba», unser «Papa» ist, können wir reden «wie uns der Schnabel gewachsen ist». Wir müssen nicht lange studieren, ob und mit welchen Worten wir unsere Anliegen vor ihn tragen dürfen.
Ein befreundeter Priester erzählte einmal, wie er zur Vorbereitung seiner Sonntagspredigt, die vom Verhältnis der Menschen zu Gott handle, am Meeresstrand spazieren ging, um Ideen zu sammeln: «Und dann ging vor mir ein Vater mit seinem kleinen Sohn an der Hand. Plötzlich blieb der Kleine stehen, schaute seinen Vater an und sagte: “Papa, Arme!” Und mit einem Griff hat ihn der Vater auf seine Schultern gehoben und hat ihn nach Hause getragen. Der Kleine hat nur so gestrahlt, als er beim Papa oben auf den Schultern sass. Da ist mir hinterher aufgegangen: Wie sind wir bei unserem Beten zu unserem Vater im Himmel manchmal kompliziert». Der kleine Junge sagte einfach in dieser Situation: «Papa, Arme!». Wenn wir doch lernen könnten, einfach so unkompliziert zu beten wie dieser kleine Junge.
Beten mit der Bibel
Die Bibel, besonders die Psalmen im Alten Testament zeigen, wie unterschiedlich die Menschen gebetet haben. Je nach ihrer Situation jubelten und tanzten sie, oder sie klagten, weinten und fluchten. Das zeigt, dass ihr Leben in ihre Gebete eingeflossen ist. Hören wir auf die Erfahrungen, die diese Menschen mit ihrem Beten gemacht haben, denn Beten kann auch «Hören» bedeuten! Hören auf das, was Gott uns sagen will, und oft redet Gott auch durch Menschen zu uns. Um dies zu hören, braucht es aber Zeiten der Stille, der Betrachtung, der Ruhe. Haben vielleicht manche Menschen heute deswegen Mühe mit dem Beten, weil dieses nichts mit ihrem konkreten Alltag mit seinen Fragen, Sorgen und Zweifeln zu tun hat? Haben viele Menschen vielleicht deshalb Mühe mit dem Beten, weil ihre Ohren bildlich oder real verstopft sind? Mutter Teresa hat einmal gesagt: «Gott spricht in der Stille unseres Herzens und wir hören zu. Und dann – aus der Fülle unseres Herzens – antworten wir. Das ist Gebet.»

Geduld ist gefragt
Wenn wir die Heilige Schrift lesen, können wir manchmal den Eindruck gewinnen: «Das ist genau meine Situation!» und von den Erzählungen in der Bibel können wir auch lernen, dass es beim Beten oft sehr viel Geduld braucht, bis Gott uns erhört.
Vieles, das uns beschäftigt, hält uns vom Beten ab. Aber je mehr wir beschäftigt sind, umso mehr sollten wir beten, denn ohne das Gebet reisst der Faden, der uns mit Gott verbindet, und wir stürzen in die einsame Gottlosigkeit hinab. Für das Gebet müssen wir nicht viele Worte machen und «plappern wie die Heiden», denn ob ein Gebet «gut» oder «schlecht» ist, hängt nicht von der Anzahl Worte ab, die wir dafür verwenden. Oft ist ein ehrlicher Seufzer oder ein Stossgebet mehr wert als stundenlanges Geplapper, das nicht von Herzen kommt.
Auf die Klage der französischen Schriftstellerin Anna de Noailles, sie höre die Stimme Gottes nicht, antwortete ihr einmal ein Bekannter: «Kein Wunder, Madame, Sie reden ja die ganze Zeit!»
Vom heiligen Pfarrer von Ars ist folgender Ausspruch überliefert: «Wer wenig betet, gleicht den Hühnern, die grosse Flügel haben und mit ihnen nichts Rechtes anfangen können. Wer innig und ausdauernd betet, wird einer Schwalbe ähnlich, die sich vom Wind tragen lässt.»
Und wie gesagt: Habt keine Angst, dass Ihr beim Beten etwas falsch macht. Denkt an den Knaben am Meeresstrand: «Papa, Arme!»
Paul Martone

In vielen Pfarreien ziehen um den 6. Januar viele Kinder in bunten Kostümen und mit glänzenden Kronen als Könige verkleidet von Haus zu Haus, um diese zu segnen, indem sie mit geweihter weisser Kreide die drei Buchstaben CMB an die Türe schreiben und für Projekte in aller Welt, die den Gleichaltrigen zugutekommen, Geld sammeln. Weit über 10’000 Kinder sind es, die beim Sternsingen mitmachen.

Die «Könige», die an diesem Tag singend von Haus zu Haus ziehen, meistens begleitet von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, von Lehrerinnen und Lehrern, oder auch vom Seelsorger, erinnern an die Heiligen Drei Könige aus der Bibel, die zu Jesus nach Bethlehem ziehen und ihm drei Geschenke geben. Man weiss zwar nicht, wie diese drei Männer geheissen haben, aber im Laufe der Jahrhunderte erhielten sie die Namen Kaspar, Melchior und Balthasar.
Viele meinen daher, die drei Buchstaben CMB, die an die Türe oder darüber auf den Türrahmen geschrieben werden (es gibt auch einen Kleber mit diesen Buchstaben) und dazu die aktuelle Jahreszahl, seien die Abkürzung für Caspar, Melchior und Balthasar. Das kann auch sein, aber heutzutage wird es meistens gelesen als: «Christus Mansionem Benedicat». Das ist Latein und heisst auf Deutsch: «Christus segne dieses Haus». Bei der Segnung eines Hauses wird also der Segen Christi erbeten, der allen Menschen, die darin wohnen, zuteilwerden soll.
Zu den drei Buchstaben kommen noch andere Zeichen, und zwar ein Stern, der den Stern von Bethlehem symbolisiert, dem die Drei Weisen damals zum Stall von Bethlehem gefolgt sind. Zwischen den Buchstaben stehen drei Kreuze für den dreifaltigen Gott: den Vater, den Sohn und den Heiliger Geist. Die Zahlen stehen für das Jahr in dem der Segen durch die Sternsinger verteilt werden. So steht dann im Jahr 2024 an der Türe zu lesen:

Das Sternsingen ist ein sinnvoller Brauch, der den Kindern in einfacher Weise einen Teil der Weihnachtsgeschichte nahebringt. Deshalb sind alle Eltern eingeladen, dieses Sternsingen in ihrer Pfarrei zu unterstützen.
Hie und da sieht man, dass einer der Drei Könige schwarz ist. Das soll keine Diskriminierung sein, sondern war einst ein Zeichen hoher Wertschätzung. Melchior galt als „Mohr“ und Vornehmster der drei. Da ein schwarz angemalter König heute aber falsch interpretiert werden kann, rät Missio Schweiz bei den Sternsingern dort vom Schminken ab, wo der Brauch nicht mehr verstanden wird oder den örtlichen Gepflogenheiten nicht mehr entspricht.
Paul Martone


Tatsächlich ist der Fisch ein Symbol, das für alle Christen gilt, auch für Protestanten, Katholiken und Orthodoxe, denn auf Griechisch heisst er ichtus, dessen Buchstaben als Abkürzung folgender Worte dienen:
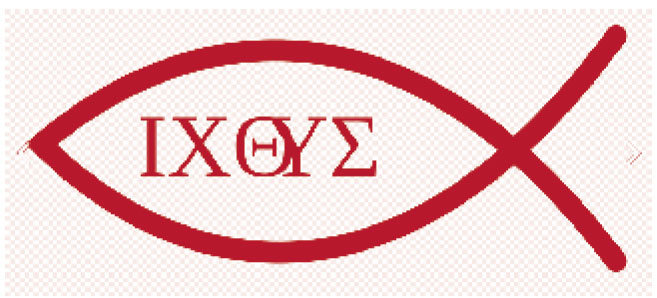
Ièsous Jesus – Christos Christus – Theou von Gott – Uios Sohn – Sôter Retter
So wurde das Kürzel von den ersten Christen in den Zeiten der Verfolgungen und Katakomben als Zeichen für ihre heimlichen Zusammenkünfte verwendet.
Der Fisch dient deshalb so gut als Bezeichnung für «Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser», weil Tiere, die im Wasser leben in der Schrift immer wieder auftauchen, bereits als Begleiter der Brote in den fünf Berichten der Evangelien über die Brotvermehrung (Matthäus 14,13 –21; 15,32–39 und Parallelen). Johannes sagt sogar, dass es ein Kind war, das fünf Gerstenbrote und zwei Fische mit sich führte, aus denen der Messias die Speise für die Menge machen wird (Johannes 6, 9).
Aber es ist vor allem der Fisch, in dessen Bauch der Prophet Jona verschlungen wird (Jona 2), auf den sich die frühe Kirche bezieht, da er das Zeichen des Ostergeheimnisses schlechthin darstellt. «Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte lang im Schoss der Erde sein» (Matthäus 12, 40, zitiert Jonas 2,1).
Auch wenn die Länge des Zeitraums zwischen der Grablegung Christi und seiner Auferstehung nicht genau dem chronologischen Plan entspricht, war es tatsächlich der dritte Tag, an dem Jesus aus dem Grab stieg und durch das Wasser des Todes ging. Es ist das einzige Zeichen, das er uns gegeben hat, aber es sagt alles: In seiner Nachfolge können wir, wie Fische im Wasser, ans andere Ufer des ewigen Lebens gelangen. Das ist katholisch, weil es evangelisch ist.
François Xavier Amherdt / Image: DR

In Bezug auf die Gestalt der Jungfrau Maria lassen sich besonders aus der Heiligen Schrift Gemeinsamkeiten zwischen Reformierten und Katholiken herstellen. Neben den Kindheitsevangelien, der Verkündigung, der Geburt Christi, der Flucht nach Ägypten und der Wiederauffindung Jesu im Tempel sowie dem Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein in Kana, bei dem Maria eine Schlüsselrolle als «Kurier» spielt, damit das Zeichen geschehen kann, ist es zweifellos die Episode am Fusse des Kreuzes im vierten Evangelium, die alle christlichen Konfessionen am besten vereinen kann.
Wenn der gekreuzigte Jesus Maria und den Jünger, den er liebte, als Mutter und Sohn einander schenkt: «Frau, siehe deinen Sohn – siehe deine Mutter» (Johannes 19, 25–27), dann schenkt er seine eigene Mutter der Gesamtheit der Christen und damit der Menschen. In der Figur des «geliebten Jüngers», die die Tradition mit dem Evangelisten Johannes in Verbindung bringt, wird die Gesamtheit derer, die sich auf den Namen Jesu Christi berufen, angenommen. Mehr noch, der menschgewordene, für die Vielen gestorbene und auferstandene Sohn Gottes schlägt allen Menschen jene, die er «Frau,» nennt, die «neue Eva», als Mutter vor.
Mutter der Menschheit
Es ist kein Zufall, dass so viele Muslime eine echte Zuneigung für die Mutter Jesu empfinden, die auch im Koran erwähnt wird, wie ich bei einem Besuch der riesigen Statue Unserer Lieben Frau vom Libanon in der Nähe von Beirut feststellen konnte: Dort gab es genauso viele verschleierte Frauen wie Christen. «Stabat Mater»: Die Mutter stand bis zum Schluss an der Seite ihres göttlichen Sohnes. Mit Luther, Calvin und Zwingli empfangen wir sie als die Mutter der Menschheit. Und auch wir bleiben vor dem Gekreuzigten stehen, um von ihm das Testament seiner Worte des Lebens, das Geschenk seiner unendlichen Liebe, das Blut der Eucharistie und das Wasser der Taufe zu empfangen. Es ist Marias Gesicht der Demut, der Einfachheit, der Beharrlichkeit und der Diskretion, das am besten die Herzen der Protestanten, Orthodoxen, Anglikaner, Evangelikalen und Katholiken berühren kann.
François-Xavier Amherdt

Beim «Eintritt» in den Monat Dezember begrüsst uns das Hochfest der Unbefleckten Empfängnis Mariens. Dieses Fest am 8. Dezember gilt als eines der Dogmen, in denen die Kirche ihre Lehre über Maria definiert. Dogmen als solche gehören nicht gerade zu den «Lieblingen» vieler Gläubigen, gilt es ja nicht als Kompliment, wenn man jemandem vorwirft, er sei dogmatisch und damit stur und unbeweglich.
Was ist ein Dogma?
Ein Dogma ist eine «Glaubenslehre der römisch-katholischen Kirche, die in der Bibel und in der Tradition der Kirche nachweislich enthalten und vom Lehramt definitiv als Offenbarungswahrheit verkündet worden ist». Dogmen wollen die Menschen nicht einengen, und sie verbieten auch nicht das Denken. Vielmehr sind sie «Lichter auf unserem Glaubensweg, sie erhellen und sichern ihn. Umgekehrt werden durch ein rechtes Leben unser Verstand und unser Herz geöffnet, um das Licht der Glaubensdogmen aufzunehmen», schreibt der Katechismus.
Dogmen sind jedoch nicht eines schönen Tages einfach so vom Himmel gefallen und bis heute unverändert überliefert worden! Die Lehre der Kirche speist sich aus zwei Quellen: die Heilige Schrift und die Überlieferung der Kirche, die über das Geheimnis Gottes und seines Sohnes nachdenkt und es in verschiedenen Lehrsätzen auslegt. Daran sind alle Gläubigen beteiligt und die «Gesamtheit der Gläubigen kann im Glauben nicht fehlgehen» und dank des Beistandes des Heiligen Geistes und durch das Studium, vor allem der theologischen Forschung kann das Verständnis der Lehre der Kirche wachsen. Nicht alle sind dann aber immer gleicher Meinung, deshalb wurde die «Aufgabe, das Wort Gottes verbindlich auszulegen, einzig dem Lehramt der Kirche, dem Papst und den in Gemeinschaft mit ihm stehenden Bischöfen anvertraut». Dogmen im engeren Sinn waren meistens Entscheidungen in einer konkreten theologischen Streitfrage. Darum sollte man, um ein Dogma richtig zu verstehen, auch den geschichtlichen Zusammenhang beachten, aus dem heraus es entstanden ist.

Mariä Unbefleckte Empfängnis
Kein Fest der Muttergottes wird so falsch verstanden, wie das Fest ihrer unbefleckten Empfängnis. Vielfach wird gefragt, wie die Kirche sich das denn vorstelle, dass Jesus von Maria am 8. Dezember unbefleckt empfangen und drei Wochen später schon geboren worden sei.
Dieses Dogma sagt jedoch nichts darüber, dass Jesus «unbefleckt» empfangen worden sei. Es besagt vielmehr, dass Maria im Schoss ihrer Mutter Anna unbefleckt empfangen wurde. Das heisst, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Menschen vom ersten Augenblick ihres Daseins an ohne Erbschuld war. Logischerweise feiern wir den Geburtstag von Maria neun Monate nach ihrer Empfängnis, also am 8. September.
Dieses Geheimnis der unbefleckten Empfängnis hat sich im Glaubensbewusstsein der Kirche erst in einer längeren Entwicklung durchgesetzt und wurde 1854 von Papst Pius IX. definiert. Über diese Glaubenswahrheit wird in der Bibel nichts überliefert wird. Die Kirche hat aber den Ansatz dieses Geheimnisses der Auserwählung von Maria im Buch Genesis gesehen, in dem die Feindschaft zwischen Eva und der Schlange, zwischen dem Nachwuchs der Frau und dem Nachwuchs der Schlange ausgedrückt ist. Schon die frühen Kirchenväter haben in diesem Nachwuchs der Frau Christus gesehen, der durch seinen Tod am Kreuz den «Schuldbrief zerrissen hat». In engster und immerwährender Verbundenheit mit ihrem Sohn hat Maria die Schlange mit ihrem Fuss zertreten. «Eine solche durchgehende und grundsätzliche Gegnerschaft Marias zur Macht des Bösen enthält aber schon die Wahrheit in sich, dass Maria eigentlich von dieser Macht niemals unterjocht und angetastet sein konnte». Sie war «voll der Gnade», wie es der Engel Gabriel bei der Verkündigung in Nazareth gesagt hat.
Karl Veitschegger beschreibt Maria im Blick auf dieses oft missverstandene Dogma: «als einen Menschen, der in moralischer Hinsicht “kern-gesund” ist, nicht infiziert von der allgemeinen Immunschwäche gegenüber dem Bösen, von der “Erbsünde”, wie die Theologen sagen. Katholischer Glaube bekennt: Vom ersten Augenblick ihres Lebens (Empfängnis) an durfte Maria ungetrübt (unbefleckt) in der Freundschaft mit Gott leben. Das ist der Sinn des missverständlichen Ausdrucks “Unbefleckte Empfängnis”. Ein unglückliches Wort für eine glückliche Sache!»

Veitschegger stellt dann auch die Frage, was das Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens für unser Leben bedeutet, und gibt dann sechs Antworten:
* Nicht nur Marias Leben, auch unser Leben ist von Gottes Liebe gewollt. In diesem Sinn ist jeder von uns ein “Wunschkind” (auch, wer es für seine Eltern nicht gewesen sein sollte). Mensch sein heisst: geliebt werden und dadurch selber lieben lernen.
* Gott bietet uns seine Freundschaft an, und diese Freundschaft kann uns befähigen, unsere Lebensaufgabe zu erfüllen, wie Maria ihre Aufgabe erfüllt hat.
* Gottes “Methoden”, das Böse in der Welt zu überwinden, haben wenig mit Härte und Gewalt, aber sehr viel mit Anmut, Milde und innerer Kraft zu tun. Bilder zum Fest des 8. Dezembers zeigen Maria sehr oft als junge, zarte Frau, der die Schlange der Bosheit entmachtet zu Füssen liegt (als Hoffnungszeichen für uns alle: vgl. Römer 16, 20)
* Recht verstandene Marienverehrung darf nicht mit “Sexualfeindlichkeit” in einen Topf geworfen werden (was leider immer wieder passiert). Denn am 8. Dezember feiern wir die Zeugung Marias, und diese geschah auf ganz natürliche und gottgewollte Weise: durch die körperliche Liebe ihrer Eltern Anna und Joachim.
* In Maria zeigt uns Gott, was reifer Glaube ist: Maria ist kein «armer Wicht», sondern eine Frau, die Gott durchaus kritische Fragen stellt (Lukas 1, 34 u. 2,48.), ihren Sohn Jesus nicht immer versteht (Lukas 2, 41– 51), sehr dunkle Stunden erleben muss (Johannes 19, 25), aber in all dem bleibt sie ein offener und lernfähiger Mensch, weil sie sich ganz und gar von Gottes Liebe getragen weiß (Lukas 1,45, 46).
* Echter Glaube ist daran zu erkennen, dass er uns menschlich reifen lässt.

Gottesgebärerin
Wir verehren Maria als die Mutter Jesu. Da wir glauben, dass Jesus sowohl Mensch als auch Gott ist, können wir sagen, dass Maria auch die Mutter Gottes ist, denn sie hat in Jesus Gott geboren. Maria hat also nicht nur einen Menschen geboren, der dann nach seiner Geburt Gott «geworden» wäre, sondern schon in ihrem Leib ist ihr Kind der wahre Sohn Gottes. Es geht also beim Titel «Gottesgebärerin» nicht zuerst um Maria, sondern um die Frage, ob Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist. Wir finden zwar in der Bibel bereits Aussagen darüber, dass Jesus von Nazaret der «Mensch gewordene Sohn Gottes» und der «Erlöser der Menschen» ist. Im Laufe der Zeit entstanden jedoch Diskussionen über die Frage, ob Jesus von Anfang an Gott gewesen sei, oder erst später von Gott aufgrund seiner Verdienste als sein Sohn adoptiert worden sei. Im Jahr 431 schuf das Konzil von Ephesus in dieser Frage Klarheit, indem es feststellte, dass Jesus nicht nur ganz Mensch, sondern auch ganz Gott ist. Deshalb darf Maria auch Gottesgebärerin genannt werden. Das Konzil stützte sich bei dieser Aussage auf die Heilige Schrift, wo im Johannesevangelium (1,14) die Rede davon ist, dass das «Wort» Fleisch geworden ist, und im Brief des Apostels Paulus an die Galater steht zu lesen, dass «Gott seinen Sohn sandte, geboren von einer Frau» (4,4). Für unser Leben bedeutet das, dass im Menschen Jesus Gott selbst zu uns gekommen ist. Gott kennt unser Leben nicht nur von den Höhen des Himmels aus, sondern auch vom Staub der Erde aus, oder wie es der heilige Augustinus sagte: «Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott werde».
Weitere Dogmen über Maria
Es gibt noch zwei weitere Mariendogmen, die wir hier nur kurz streifen können:
Immerwährende Jungfräulichkeit
Dieses Dogma, das auf dem 2. Konzil von Konstantinopel im Jahr 553 anerkannt wurde, besagt dass Maria immer Jungfrau geblieben ist – auch während und nach der Geburt Jesu. Dies ist für das Leben Jesu grundlegend, denn es hält fest, «dass er von einer Frau geboren wurde, aber keinen menschlichen Vater hat. Jesus Christus ist ein von oben gestifteter neuer Anfang der Welt» (Youcat Nr. 80).

Maria Aufnahme in den Himmel
Dieses ist das jüngste Dogma und wurde 1950 von Papst Pius XII. verkündet. Es sagt, dass Maria nicht gestorben, sondern entschlafen ist. Der zentrale Gedanke dieses Dogmas liegt darin, dass Maria als einziger Mensch nach Christus und in seinem Gefolge mit Seele und Leib in die Vollendung des Himmels einging, als sie ihren irdischen Lauf vollendet hatte. Für uns bedeutet dies, dass unser Leben, auch unser leibliches, für Grosses bestimmt ist. In Maria zeigt Gott uns exemplarisch unsere eigene Zukunft: Wir haben Anteil an der Auferstehung Jesu Christi, an der Herrlichkeit Gottes.
Paul Martone


Wir wissen, dass Maria die Mutter Jesu war. Somit hatte Jesus auch Grosseltern. Weiss man über diese Personen etwas?
Selbstverständlich hatte Jesus auch Grosseltern. Sie hiessen Anna und Joachim.
Von denen habe ich der Bibel aber noch nie etwas gelesen.
Die Grosseltern Jesu erscheinen in der Bibel nicht. Erst eine christliche Schrift aus dem zweiten Jahrhundert («Protoevangelium des Jakobus») nennt die Namen der Eltern Marias, der Mutter Jesu.
Weiss man Näheres über das Leben der beiden?
Leider ist ihr Leben nur von Legenden umrankt. So wird berichtet, dass sie sehnsüchtig und lange auf ein Kind gewartet und darum gebetet haben sollen. Ihr Wunsch soll erst spät durch die Geburt einer Tochter in Erfüllung gegangen sein, die die Mutter Jesu wurde.
Gibt es einen kirchlichen Gedenktag für die Grosseltern Jesu?
Ja, den gibt es tatsächlich, und zwar feiern wir ihn jedes Jahr am 26. Juli. Um die Bedeutung der Grosseltern zu betonen und die Rolle älterer Menschen zu stärken, hat Papst Franziskus im Jahr 2021 einen «Welttag für Grosseltern und Senioren» eingeführt, der jährlich am vierten Sonntag im Juli begangen wird.
Wie kam man denn auf die Namen Anna und Joachim?
Auch das ist eine Erfindung, doch passen die beiden Namen gut zu den Grosseltern. Anna bedeutet nämlich Liebe, Anmut, Gnade, Erbarmen, Freundlichkeit. Joachim kann man so übersetzen: Gott hat aufgerichtet; Gott gibt Beständigkeit.
Ein Wort zu den Grosseltern insgesamt
Grosseltern sind wichtig. Sie sind ein Schatz in der Familie. Sie helfen nicht nur aus, wenn die Eltern beschäftigt sind, sondern bringen auch eine Fülle von Wissen und eine einzigartige Perspektive mit, die sie mit den jüngeren Generationen teilen können. Ihre Worte der Liebe und Zuneigung erreichen das Herz ihrer Enkelkinder und eröffnen ihnen durch die Lebenserfahrung und den Glauben der Grosseltern einen weiten Horizont, der den Enkeln und Enkelinnen hilft, gut im Leben zu stehen. Glücklich alle, die liebevolle Grosseltern hatten und haben, die ihnen mit Güte und Verständnis begegneten und sie verwöhnten. Wir sollten nicht vergessen, ihnen immer wieder zu danken und für sie zu beten.
Besten Dank für die Auskunft. pam

2. Dezember
Einer soll dem anderen helfen, seine Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz Christi . (Gal 6, 2)
Das ist ja ganz schön hart – ich, der ich selbst täglich unter irgendwelchen Lasten stöhne, soll noch die Lasten anderer mittragen, erleichtern helfen? Doch ich kann es auch so sehen: Ich mit meinen Lasten erwarte oft genug von anderen, dass sie mir ein Rundum-Beistand sind. Und vergesse dabei, dass die anderen ja ebenfalls ihre Lasten haben.
Wenn ich das erkenne, kann ich begreifen, dass weder ein anderer mir, noch ich dem anderen alle Bedürfnisse befriedigen kann. Aber: Wo immer es möglich ist, sollte man einander liebevoll helfen.
Gott, lass mich im Rahmen meiner Möglichkeiten anderen ihre Last erleichtern.Amen.
30. Dezember
Ein anderes Buch wurde aufgetan – nämlich das des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach ihren Werken – wie es geschrieben steht in den Büchern.(Offb 20, 12)
Wenn ich mein Leben als Buch und jeden Tag als Seite sehe, kann ich am Ende eines Tages kritisch die Seite noch einmal überblicken und einen Schlusspunkt setzen. Und schlage dann die nächste Seite auf, habe eine neue, einmalige Chance.
Am Jüngsten Tag wird jede Seite meines Lebensbuches berücksichtigt. Ich muss nicht perfekt gewesen sein, sondern mich täglich um das Gute bemüht haben. Die entscheidende Frage im Endgericht: Hast du mit ganzer Kraft geglaubt, gehofft, geliebt?
Gott, lass mich jeden meiner Tage verantwortungsvoll leben. Amen.
Das Buch aus dem Styria-Verlag ist in jeder Buchhandlung erhältlich

Mama, wer ist das Christkind?
Weihnachten ist für viele Kinder das Highlight des Jahres, denn es warten viele Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, die zahlreiche Träume erfüllen und Wünsche wahr werden lassen.
Doch wie kann man als Eltern seinem Kind erklären, was der Inhalt dieses Festes ist?
Als Eltern, die im christlichen Glauben verwurzelt sind, ist es wichtig, vom Christkind zu sprechen und nicht vom Weihnachtsmann. Dieser freundliche, füllige «Kerl» mit seiner roten Zipfelmütze hat mit diesem Fest nichts zu tun. Er ist eine Erfindung der Firma Coca Cola, die damit den Verkauf ihres Produktes ankurbeln wollte. Er ist ein billiger Abklatsch des heiligen Nikolaus, dessen Fest wir am 6. Dezember feiern.
Reden Sie mit ihren Kindern immer vom Christkind, von Jesus Christus, den Maria geboren hat. Seinen Geburtstag feiern wir an Weihnachten. Er ist vom Himmel gekommen, um den Menschen auf der Erde Frieden und Glück zu bringen. Als Jesus in Bethlehem geboren wurde, haben sich die Heiligen Drei Könige aufgemacht, ihn zu suchen. Weil er ein besonderes Kind war, brachten sie ihm Geschenke mit. Und diese Tradition lebt heute weiter. Wir beschenken aber nicht das Christkind, das Geburtstag hat, sondern dieses Geburtstagskind beschenkt uns. Jesus ist das grosse Geschenk, das unser Vater im Himmel uns gemacht hat, damit auch wir eines Tages in den Himmel kommen. Dieses grosse Glück wollen wir teilen, denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück. Darum beschenken sich an Weihnachten auch viele Menschen, um einander zu zeigen, dass sie sich lieben und sich gerne haben. Damit machen sie dem Christkind die grösste Freude, denn als Jesus erwachsen war, hat er immer davon geredet, dass Gott die Menschen liebt und die Menschen einander ebenfalls lieben sollten und dass kein Streit auf der Erde sein sollte.
Verkitschen Sie das Christkind aber nicht, sondern erzählen sie den Kindern auch, dass die Menschen schon damals diese Wünsche von Jesus nicht erfüllt haben. Jesus musste viel Leid erfahren und er ist aus Liebe zu uns sogar am Kreuz gestorben.
Wir wissen, dass es auch heute noch viel Leid und Krieg, Streit und Hass gibt. Deshalb ist es das grösste Geschenk, das wir Jesus machen können, wenn wir uns einsetzen, damit der Friede auch in unsere Welt kommen kann, indem wir nach jedem Streit bereit sind, einander die Hand zum Frieden zu geben, niemanden ausschliessen, mit allen freundlich sind und immer bereit sind zu verzeihen.
Das könnten wir uns dieses Jahr doch besonders vornehmen und das wäre ein schönes Weihnachtsfest!
Paul Martone
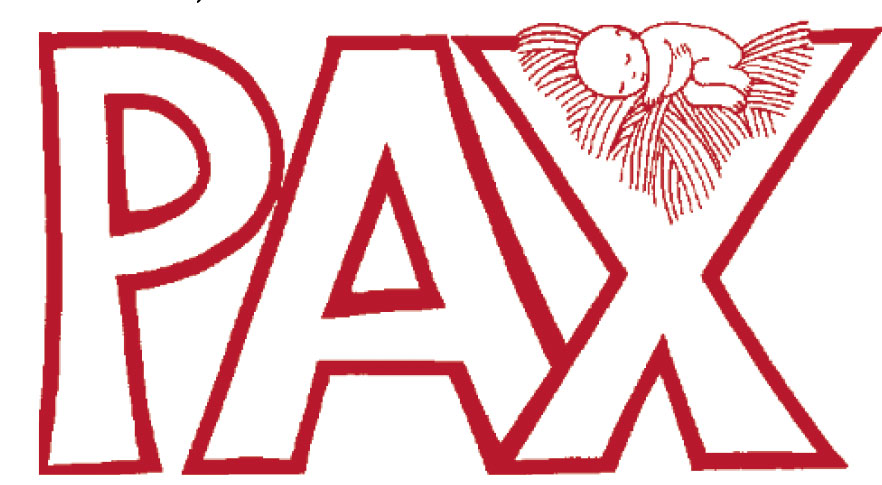

Seit etwas mehr als 35 Jahren bin ich Priester und in dieser Zeit habe ich ungezählten Frauen und Männern das Sakrament der Krankensalbung gespendet. Es ist das Sakrament der Stärkung, der Hoffnung und der Heilung. Gott verspricht in diesem Sakrament, dass er fühlbar auf unserem Lebensweg mitgeht, auch dann, wenn wir krank, alt und gebrechlich sind. Ja, der Herr, der um das Leiden weiss, weil er selber furchtbar gelitten hat, will den Kranken vielleicht sogar in dramatischer Weise ganz nahe sein und sie aufrichten.
Leider ist dieses schöne Zeichen der göttlichen Nähe mit zahlreichen negativen Gefühlen, ja sogar mit Ängsten belastet. Viele Menschen betrachten diese Salbung als Zeichen des Lebensendes, das so lange hinausgezögert wird, bis wirklich «das letzte Stündlein geschlagen hat». Der Priester, der zu den Kranken kommt, um ihnen dieses Sakrament zu spenden, wird dann als Bote des Todes angesehen, der noch schnell kommt, um die «letzte Ölung» wie die Krankensalbung im Volk hiess, zu spenden. Und wehe, der Patient stirbt dann nicht, denn, so war es bei vielen Menschen weit verbreitet, habe man den immer beschäftigten Priester für nichts bemüht.
Eine betagte Frau telefoniert ihrer Tochter: «Stell dir vor, heute war der Pfarrer bei mir und wollte mir die Krankensalbung geben. Bin ich wirklich schon so krank, dass es zu Ende geht?» (Esther Z.)
Dabei tritt mit dem Priester Jesus selbst an das Bett des Kranken, um ihm Trost, Frieden und Kraft zu schenken, manche Kranke erhalten dadurch neuen Lebensmut und werden sogar geheilt. Deshalb ist es falsch, wenn man den Priester für eine Krankensalbung erst dann ruft, wenn nichts mehr zu machen ist und der kranke Mensch bereits in den letzten Zügen liegt. Vielmehr ist es gut und sinnvoll die Krankensalbung zu spenden, wenn der Patient noch bei Bewusstsein ist. Es ist dabei egal, ob man alt oder jung ist. Auch in schlimmen seelischen Nöten oder vor einer Operation kann ein Mensch die Krankensalbung empfangen. Das Alter spielt bei der Krankensalbung keine Rolle. Selbstverständlich können auch junge Menschen und auch Kinder die Krankensalbung empfangen.
«Ich hatte grosse Angst vor der Krankensalbung, da ich doch nicht sterben wollte. Doch als ich dann dazu Ja sagen konnte, blickte ich zuversichtlich auf das, was vor mir liegt ist.» (Linda R.)

Im Gegensatz zur Taufe oder der Firmung ist die Krankensalbung ein Sakrament, das so oft empfangen werden kann, wie ein Mensch sie braucht.
Bei der Krankensalbung spricht der Priester: «Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er dich auf.» P. Karl Wallner hat recht, wenn er schreibt: «Das Sakrament bewirkt also das “Aufrichten” und oft kann man es erleben, dass jemand nach der Krankensalbung auch körperlich wieder gesund wird. Jesus lässt uns auch dann nicht allein, wenn wir krank und verzagt sind. Gerade dann möchte er ganz bei uns sein! Wie das Öl unter den Gebeten des Priesters in die Haut des Kranken “einzieht”, so zieht die Kraft Gottes in die Seele ein. Der Kranke kann erfahren, dass Gott ihn liebt, dass er ihm die Gesundheit des Lebens schenken möchte, und sogar noch mehr: die ewige Herrlichkeit des Himmels.»
«Nachdem mir der Pfarrer im Spital die Kranken-salbung gespendet hat, ist es mit meiner Gesundheit wieder aufwärts gegangen, so dass ich eine Woche später wieder nach Hause gehen konnte». (Franz H.)

Ich habe immer wieder erlebt, dass vor der Spendung der Krankensalbung die Besucher oder auch die Familienangehörigen das Zimmer verlassen. Manche wollen nicht stören, manche fürchten sich vielleicht auch, an ihre eigene Vergänglichkeit erinnert zu werden. Dabei brauchen Menschen, die krank sind, gerade in einer solchen Situation menschliche Gemeinschaft und ein wirksames Zeichen göttlichen Segenszuspruchs, die die Krankensalbung schenken kann. Die Feier der Krankensalbung soll deshalb, wenn immer möglich, in Gemeinschaft stattfinden. Das kann die Gemeinschaft der Familie und Freunde um das Krankenbett sein, das kann aber auch die gemeinsame Feier der Krankensalbung bei einer Wallfahrt oder in der Pfarrei sein, etwa im Rahmen des Krankensonntags, der in der Schweiz jedes Jahr im März gefeiert wird. Diese Gemeinschaft kommt auch darin zum Ausdruck, dass das Öl, das bei einer Krankensalbung verwendet wird, jedes Jahr in der Chrisammesse am Gründonnerstag (oder an einem anderen geeigneten Tag der Fastenzeit) vom Bischof geweiht wird. Anschliessend wird dieses Öl in die verschiedenen Pfarreien gebracht. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass wir alle in gesunden aber auch in kranken Tagen zu einer grossen Gemeinschaft gehören, die sich Kirche nennt. Ausserdem kommt in der Weihe der Öle vor Ostern zum Ausdruck, dass die Sakramente Anteil an Christus schenken, der lebt und nicht mehr sterben wird. Was immer im Verlauf der Krankheit noch passieren wird, diesen Anteil am Leben kann keine Krankheit auslöschen.
«Ich bin immer dankbar, wenn ich einem Menschen die Krankensalbung spenden darf, denn sie ist für mich der letzte Liebesdienst, den ich einer Person tun kann.» (Pfarrer Robert Z.)
Die Krankensalbung darf nicht mit dem Sterbesakrament verwechselt werden. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird die Wegzehrung als das eigentliche Sterbesakrament bezeichnet. Dabei empfängt der Sterbende zum letzten Mal die heilige Kommunion, die auch eine Kommunionhelferin oder ein Kommunionhelfer spenden kann. Die Kommunion ist dann die Wegzehrung, für den Übergang vom Leben durch den Tod ins ewige Leben -eventuell in Verbindung mit der persönlichen Beichte. Die Krankensalbung schliesst auch die Sündenvergebung ein, damit keine Schuld die Kranken von Gott trenne. Deshalb ist sie dem geweihten Priester reserviert. Als Sakrament der befreienden Zusage Gottes kann die Krankensalbung auch an Bewusstlose erteilt werden. Angehörige oder das Klinikpersonal sollen jedoch dafür sorgen, dass es erst nicht so weit kommt, sondern dass der Kranke das Sakrament bei Bewusstsein empfangen und es somit persönlich bejahen kann.
«Nachdem ich die Krankensalbung empfangen hatte, erfüllte mich eine grosse innere Ruhe und Zuversicht, denn ich wusste nun, dass Jesus auch im Operationssaal bei mir ist.» (Melanie A.)
Hie und da wird der Priester auch gerufen, einem Menschen, der gerade gestorben ist, noch die Krankensalbung zu spenden. Dies ist nicht möglich, denn wir sehen die Krankensalbung als Zeichen des Lebens. Sie soll helfen und stärken und steht für die Nähe Gottes. Es ist nicht sinnvoll darum zu beten, dass ein Verstorbener aufgerichtet wird, damit er sich wieder seinen Aufgaben widmen kann. Gerade auch deshalb ist es wichtig, rechtzeitig einen Priester zu rufen. Auch wenn jemand krank im Spital liegt, kann man den Krankenseelsorger und die Krankenseelsorgerin bitten, einen Priester für die Krankensalbung zu holen.

Die Spendung des Sakramentes besteht aus drei Teilen: der Eröffnung, dem Wortgottesdienst und der Feier der Salbung. Nach der Begrüssung spricht der Priester das Eröffnungsgebet. Es folgt die Beichte oder das Schuldbekenntnis. Im anschliessenden Wortgottesdienst wird ein Text aus dem Evangelium vorgelesen und so ausgelegt, dass der Kranke sich angesprochen fühlt. Nach den Fürbitten legt der Priester dem Kranken die Hände auf. Diese stille Handauflegung ist eine alte Gebetsgebärde. Sie drückt die Bitte um das Vertrauen aus, der Heilige Geist möge auf einen Menschen herabkommen und ihm seine Kraft einhauchen.
Die wohltuende, heilsame und pflegende Wirkung von Öl ist bekannt. Schon allein deshalb ist die Salbung mit Öl ein deutliches Zeichen, das vom heilsamen Wirken Gottes spricht.

Das Gebet zur Weihe des Krankenöls
zeigt sehr schön,
wie das Sakrament der Krankensalbung
verstanden werden soll:
«Herr und Gott, du Vater allen Trostes.
Du hast deinen Sohn gesandt,
den Kranken in ihren Leiden
Heilung zu bringen.
So bitten wir dich:
Erhöre unser gläubiges Gebet.
Sende deinen Heiligen Geist
vom Himmel her
auf dieses Salböl herab.
Als Gabe deiner Schöpfung
stärkt und belebt es den Leib.
Durch deinen Segen
werde das geweihte Öl
für alle, die wir damit salben,
ein heiliges Zeichen deines Erbarmens,
das Krankheit,
Schmerz und Bedrängnis vertreibt,
heilsam für den Leib, für Seele und Geist.»
Bei der Salbung der Stirn des Kranken spricht der Priester folgendes Gebet: «Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes.»
Bei der Salbung der Handinnenflächen betet er: «Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er dich auf.»
Paul Martone
Schon in der Antike diente Öl als Nahrung, Medizin und Kosmetikum. Es gehört neben Brot, Wein und Wasser zu den Grundsubstanzen der christlichen Liturgie. Salbungen mit Öl sind bereits in biblischer Zeit bezeugt. Auch heute noch finden Salbungen bei der Spendung einiger Sakramente und Sakramentalien der Kirche statt. Die Gläubigen sollen durch die Salbung, insbesondere mit Chrisam (Myron), daran erinnert werden, dass sie zu Christus gehören, der gesalbt ist zum König und Propheten. Messias beziehungsweise Christus bedeutet der Gesalbte.
Gewöhnlich in den Kathedralkirchen werden jedes Jahr am Gründonnerstag (oder einem ihm vorausgehenden, osternahen Tag) in der Chrisammesse die heiligen Öle gesegnet, der Chrisma geweiht. Die Öle werden hierfür in grosse Kannen gefüllt. Wo Tücher zum Schmuck oder zur Verhüllung benutzt werden, sind sie traditionell in den Farben weiss (Chrisam), grün (Katechumenenöl) und violett (Krankenöl) gehalten. Nach der Feier werden die Öle an die Kirchen in der Diözese verteilt.
Die Öle werden für den liturgischen Gebrauch meist in kleinere Gefässe umgefüllt. Je nach Verwendung variieren diese Ölgefässe in Grösse und Ausführung. Echtes Silber, versilbertes Messing oder Kupfer, aber auch Zinn kommen zur Anwendung. Oft haben die Ölgefässe einen Deckel mit Schraubgewinde, um das Auslaufen der dünnflüssigen Öle zu verhindern. In manchen Kirchen werden die heiligen Öle in einem Schrein in der Nähe des Taufbrunnens aufbewahrt, häufiger aber in der Sakristei. Reste der heiligen Öle des vergangenen Jahres können in der Osternacht im Osterfeuer verbrannt oder ins Sakrarium gegossen werden.

Es ist wohl eine der schwierigsten Aufgaben, einem Kind zu erklären, warum jemand krank wird und manchmal sogar nach einem langen Leidensweg stirbt. Wichtig ist es, den Kindern verständlich zu machen, dass Gott den Menschen auch nahe ist, wenn sie krank sind. Ja, er hat uns sogar ein grosses Geschenk gemacht, das uns diese Nähe zeigt, nämlich die Krankensalbung. Mit der Krankensalbung folgt die Kirche dem Vorbild Jesus. Auch er hat Kranke geheilt und auch seine Jünger aufgefordert, das zu tun.

Diese «ist der Treffpunkt, an dem Gott kranken und kraftlos gewordenen Menschen mit seiner Kraft zu Hilfe kommt». Gott schenkt uns in der Krankensalbung Trost, Frieden und Kraft. Der kranke Mensch trifft Jesus, der ihn stärkt. Der Kranke kann erfahren, dass er mit seiner Krankheit, mit seinem Leid, mit seinem Schicksal nicht alleine ist. Er kann die Nähe und die Zuwendung Gottes spüren. Manche Kranke werden dadurch sogar geheilt, denn die Krankensalbung soll die Heilkräfte kranker Menschen stärken und sie auch von ihren Sünden befreien, denn auch Sünden können krank machen. Damit meine ich, Dinge, Verhalten, Dummheiten, die wir Menschen in unserem Leben hie und da machen und die uns schwer auf dem Herzen liegen können.
Selbst wenn die Menschen, die wir lieb haben, sterben müssen, dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus sie auch in diesem Moment nicht alleine lässt. Vielmehr ist er der Einzige, der uns nicht nur beim Sterben zur Seite steht und uns begleitet, sondern er kann uns durch den Tod hindurch ins himmlische Leben führen.
Oft spendet der Priester dem Kranken auch das Sakrament der Busse, in dem Gott ihm noch einmal alle Fehler verzeiht. Ausserdem erhält der Mensch dann zur Stärkung die Kommunion. Die Krankensalbung kann bei Krankheiten (auch psychischen) gespendet werden, vor Operationen und immer, wenn ein Kranker das Gefühl hat, diese Stärkung zu benötigen. Auch Kindern kann dieses Sakrament, dieses Zeichen der Liebe und Nähe Gottes gespendet werden.
Kurz gesagt: Die Krankensalbung will stärken, beruhigen, ermutigen – Heil schenken für Leib und Seele.
Paul Martone
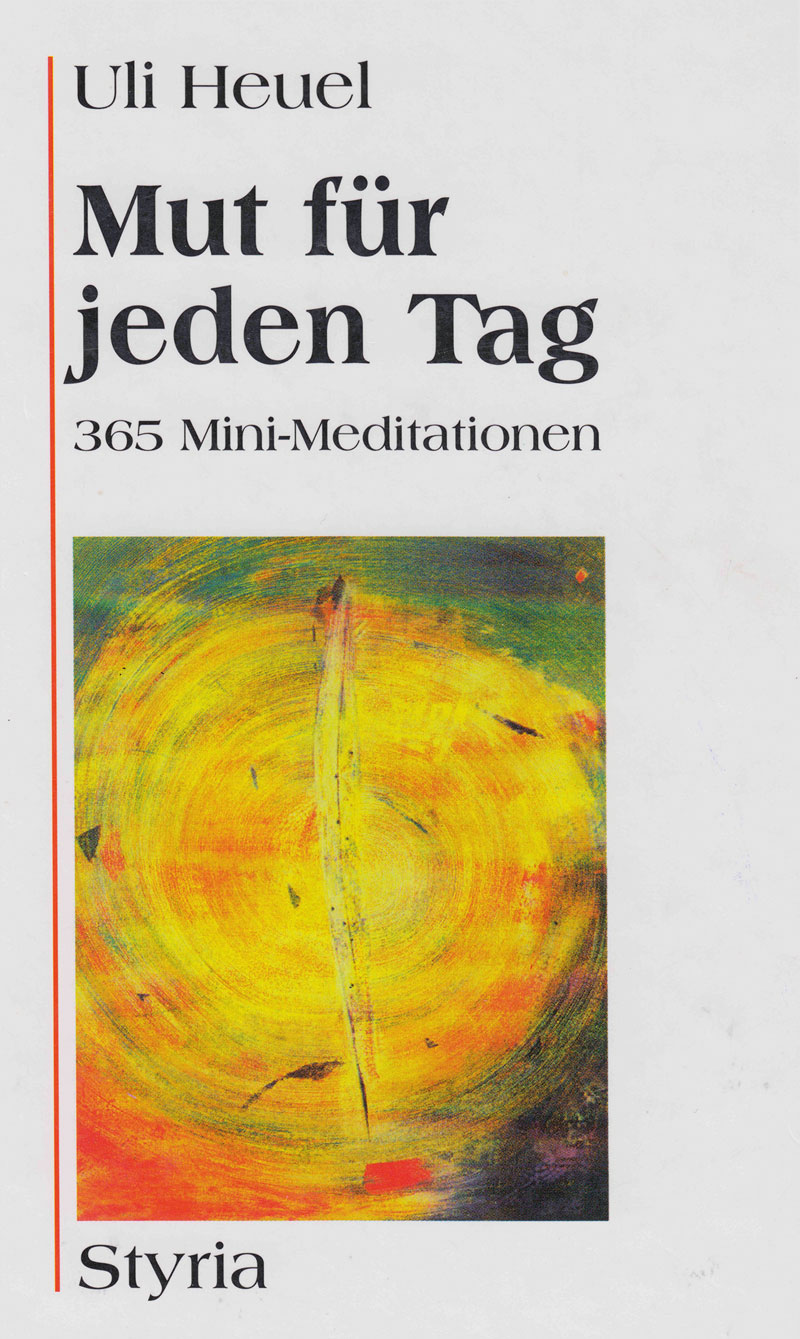
2. November
Ich sage euch: Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt geringachtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss denselben Weg gehen wie ich, und wo ich bin, wird mein Diener auch sein. (Joh 12, 24–25.26;GN)
Sinnvoll und gut: Eigenliebe als eigennütziges Handeln, Lebenslust. Doch kann’s in Eigensucht und Lebenssucht ausarten – in krampfhaftes Bemühen, von jedem Regentropfen verschont zu bleiben, den besten Platz an der Sonne zu erwischen, auf Kosten anderer. Vielleicht noch verbunden mit übermässigen Gefühlen rührseliger Selbstverliebtheit. Dauerndes Kreisen um sich macht auch blind für Gott und Menschen. Gesundes «Ja» zur Selbstliebe und zur liebenden, dienenden Hingabe an andere, gelassenes «Ja» zu Regen und Sturm als Reifungsstufen – das allein bringt Frucht, wächst ins umfassende Leben.
Gott, bewahre micht vor ichversessener Hemmungslosigkeit und Selbstanbetung, vor der Krankheit des Egoismus, vor Lebenssucht, die zum Lebensverlust führt. Amen
29. November
Ich bin fest überzeugt, dass ich euren Superaposteln in nichts nachstehe. Niemand soll glauben, ich sei nicht ganz bei Verstand. Aber wenn es einer so meint, dann soll er es eben so nehmen, damit ich mich auch ein klein wenig anpreisen kann. Weil so viele sich auf ihre Vorzüge berufen, will ich es auch einmal tun. (2 Kor 11, 15.16.18; GN)
Auch wenn Paulus das Eigenlob hier ironisch meint – es ist gar nicht so übel, sich nach Anstrengungen und Erfolg einmal selbst kräftig zu loben – im stillen Kämmerlein oder, ohne Prahlerei, vor anderen. Es ist nicht übel, sich fernab falscher Bescheidenheit von anderen anerkennend auf die Schulter klopfen zu lassen.
Freunde über Erreichtes, Stolz auf mich, Lob und Anerkennung – das brauche ich, um selbstbewusst aufzublühen. Und – nicht vergessen: Danbarkeit gegenüber dem Gott, der mir liebend und helfend zur Seite steht.
Gott, befreie mich von der Hemmung, auf mich selbst einmal stolz zu sein. Amen
Das Buch aus dem Styria-Verlag ist in jeder Buchhandlung erhältlich

Ich bin nun in einem Alter, in dem ich mich immer mehr mit dem Tod beschäftige und die damit verbundenen organisatorischen Fragen.
Ich finde diese Haltung gut, denn es ist besser, solche Fragen rechtzeitig zu regeln, denn bei einem Todesfall stehen die Angehörigen oft unter grossem seelischem Stress und müssen dann in dieser schwierigen Situation zahlreiche Entscheidungen treffen und Formalitäten regeln. Wie kann ich ihnen helfen?
Ich überlege mir, ob ich eine Erdbestattung möchte, oder doch lieber eine Kremation. Ist es in der katholischen Kirche erlaubt, seinen Leichnam verbrennen zu lassen?
Für Katholiken war eine Einäscherung während vielen Jahrhunderten verboten. Erst 1963 wurde diese auch katholischen Christen erlaubt.
Warum war sie denn so lange verboten?
Die Kirche war der Meinung, dass die Auferstehung des Leibes besser symbolisiert sei, wenn man den Leib vorher nicht zerstört und vernichtet, sondern ihn als Leichnam beisetzt. Bei der Bestattung wird gebetet: «Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück». Hinzu kam, dass Atheisten und Freimaurer argumentierten, sie würden ihren Körper verbrennen lassen, um damit zu zeigen, dass sie nicht an eine Auferstehung der Toten glauben. Davon wollte sich die Kirche abgrenzen.
Und warum darf man denn heute einen Verstorbenen verbrennen?
Heute wissen wir hoffentlich alle, dass theologisch gesehen die Auferstehung des Leibes oder des Fleisches nicht an irgendwelche Überreste gebunden ist. Vielmehr werden wir mit einem anderen, einem neuen, einem geistigen Leib auferstehen. Dafür brauchen wir unseren bisherigen Leib nicht mehr.
Dann darf sich ein Katholik heute ohne Gewissensbisse kremieren lassen?
Im Blick auf den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu ist für die katholische Kirche die Erdbestattung des Leichnams die beste Form, um den Glauben an unsere Auferstehung zum Ausdruck zu bringen. Doch die Art der Bestattung ist eine Entscheidung jedes Einzelnen, die zu respektieren ist, doch sollte jede Bestattungsform der Ehrfurcht und Achtung, die den Leibern der Verstorbenen gebührt, entsprechen.
Herzlichen Dank für die Auskunft. pam

Der Glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, den wir im Glaubensbekenntnis bekennen, setzt uns in Christus in Beziehung zu den Lebenden und den Verstorbenen. An diese Überzeugung knüpft Theresia von Lisieux an, wenn sie sagt: «Ich werde meinen Himmel damit verbringen, auf der Erde Gutes zu tun.» So wie die Gemeinschaft unter Brüdern und Schwestern auf der Erde uns Jesus Christus näherbringt, der in uns wohnt, wenn wir einander lieben, so vereint uns die Gemeinschaft mit den Heiligen im Himmel – denjenigen, die von der Kirche offiziell anerkannt und dem Gedächtnis der Gläubigen empfohlen werden, sowie unseren verstorbenen Angehörigen, deren Wohlwollen wir erfahren durften – mit dem Sohn Gottes. Von ihm geht alle Gnade aus. Durch ihn handeln die Glieder des Gottesvolkes als ein Leib.
Daher beten wir auch weiterhin für die Toten (vgl. 2 Makkabäer 12, 45) und empfehlen sie der unendlichen Güte des Vaters. In einem gemeinsamen Lobpreis der heiligsten Dreifaltigkeit bilden so alle Kinder Gottes eine einzige Familie, jenseits von Raum und Zeit, und entsprechen damit der tiefsten Berufung der Kirche.
Ungesunde Neugier vermeiden
Die Bibel und die Tradition haben hingegen immer Praktiken abgelehnt, die versuchen, «direkt» mit den Verstorbenen zu kommunizieren: «Man soll bei dir niemanden finden, der Gespenster und Wahrsager befragt oder die Toten beschwört.» (Deuteronomium 18,10; siehe auch Jeremia 29, 8) Die Schrift fordert uns auf, uns in Bezug auf die Zukunft völlig in die Hände der Vorsehung zu geben und jede ungesunde Neugier über das Jenseits fallen zu lassen (vgl. Matthäus 6, 25-34).
Geheime Mächte
In der Tat verbirgt sich hinter der Beschwörung der Toten, der Inanspruchnahme von Medien und Sehern der Wunsch, die Geschichte und die Zeit in den Griff zu bekommen, und der Wunsch, sich mit den geheimen Mächten zu versöhnen, die sich dagegen wehren, dass alle Zärtlichkeit und Barmherzigkeit in die Hände des Herrn gelegt werden.
François-Xavier Amherdt


Wort des Direktors von Missio Schweiz
Der diesjährige Monat der Weltmission im Oktober mit seinem Motto «Brennende Herzen, begeisterte Schritte» steht ganz im Zeichen des Sich-weltweit-auf-den Weg-Machens im Geiste des Evangeliums für das Heil der Menschen.
Die Geschichte von der Erscheinung Jesu auf dem Weg zweier Jünger nach Emmaus (Lk 24,13–35) steht dabei im Mittelpunkt. Sie führt uns lebhaft den Wandel von der Schwermut zur Freude und von der Mutlosigkeit zur Beherztheit vor Augen und zeigt uns, dass Gott und die Verbundenheit mit ihm der Schlüssel zu diesem Wandel sind, der freilich Zeit und Raum braucht.
In diesen Zeitraum fällt auch die Bischofssynode mit dem Thema «Für eine synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Mission». Auch hier sind wir alle – Bischöfe, Priester, Diakone und Laien – und zwar weltweit von Gott gerufen, uns zusammen auf den Weg der Erneuerung der Kirche zu machen und uns aktiv an ihrer missionarischen Sendung zum Heil der Welt zu beteiligen.
Besonders wollen wir dieses Jahr geistig gemeinsam unterwegs sein mit der Katholischen Kirche in Ecuador. Mehr zu unseren dort lebenden Glaubensschwestern und -brüdern erfahren Sie in den nachfolgenden Seiten.
Wir danken Ihnen, dass Sie die Kollekte zum Sonntag der Weltmission am 22. Oktober tatkräftig unterstützen, um ein Zeichen der weltumspannenden kirchlichen Solidarität zu setzen.
Dr. Erwin Tanner-Tizian , Direktor von Missio Schweiz

Ecuador ist mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, von denen hier einige Beispiele aufgezählt werden sollen:
– Umweltschutz: Bergbau und Ölförderung gefährden die Bevölkerung (Landrutsche, Unfälle) und die Luft- und Wasserverschmutzung das Ökosystem.
– Bildung: Der Zugang zur Schule für die Kinder der indigenen Stämme (Shuar, Saraguros), die in Bergregionen leben und nur von der Landwirtschaft leben, ist nicht gesichert.
– Sicherheit: Besonders in der Region von Esmeraldas im Nordwesten des Landes gibt es viel Unsicherheit, Gewalt und illegalen Handel, besonders mit Drogen und Waffen.
– Gesundheit: Es gibt nur sehr wenige Krankenhäuser und Heime für ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen, die tadellos funktionieren.
– Kultur und Gesellschaft: Rund 80 % der Bevölkerung sind Mestizen; wie können die Kultur, die Sprachen und die Lebensweise der ethnischen Minderheiten (Ureinwohner, Afroecuadorianer und Weisse) berücksichtigt und gleichzeitig die Einheit des Landes gewährleistet werden?

Ecuador wurde im 16. Jahrhundert von den Spaniern erobert und 1830 unabhängig. Das Land hat 18 Millionen Einwohner und ist sieben Mal so gross wie die Schweiz. Aufgrund seiner verschiedenen Regionen (Pazifikküste, Amazonas-Regenwald, Andengebirge, Galapagos-Archipel) beherbergt das Land eine grosse biologische Vielfalt. Die exportorientierte Wirtschaft Ecuadors basiert hauptsächlich auf vier Elementen: Bananenanbau (weltweit der grösste Exporteur), Erdöl, Kakao und Tourismus. Auf lokaler Ebene sind Kunsthandwerk, Landwirtschaft und Fischerei weitere wichtige Einkommensquellen.

Eine denkwürdige Reise
Während ihrer Reise konnte sich Missio-Schweiz ein konkretes Bild vom Engagement der Kirche bei der Bevölkerung für mehr soziale Gerechtigkeit machen. Die Kirche baut Schulen, betreibt Spitäler und legt in der Region Zamora sogar Strassen an. Im Apostolischen Vikariat Esmeraldas betreibt sie ein Spital und ein Altersheim; in Guadalupe werden sie von Ordensfrauen geführt. Sr. Marina, die Nationaldirektorin von Missio in Quito, hat bewusst eine alleinerziehende Mutter angestellt. Bischöfe, Priester, Ordensleute und Katechist:innen stehen wirklich an vorderster Front, um das Evangelium durch Taten zu bezeugen.
Mit seiner Botschaft zum Monat der Weltmission regt uns Papst Franziskus zum Nachdenken, Beten und Handeln an. Hier einige Auszüge aus seinem Schreiben:
Für den diesjährigen Weltmissionssonntag habe ich ein Thema gewählt, das von dem Bericht über die Emmausjünger im Lukasevangelium (vgl. 24,1-35) ausgeht: «Brennende Herzen, begeisterte Schritte».
Nachdem er den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus zugehört hatte, legte ihnen der auferstandene Jesus «dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht» (Lk 24, 27). Und den Jüngern wurde warm ums Herz: Denn Jesus ist das lebendige Wort, das allein das Herz zum Brennen bringen und es erleuchten und verwandeln kann.

… Nachdem sie die Augen aufgetan hatten und Jesus im «Brechen des Brotes» erkannten, «brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück» (vgl. Lk 24, 33). Dieses eilige Gehen, um die Freude über die Begegnung mit dem Herrn mit anderen zu teilen, zeigt: «Die Freude des Evan-
geliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer – und immer wieder – die Freude» (Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 1).
… Das Bild der «begeisterten Schritte» erinnert uns noch einmal an die immerwährende Gültigkeit der missio ad gentes, des Auftrags, den der auferstandene Herr der Kirche gegeben hat, jedem Menschen und jedem Volk bis an die Enden der Erde das Evangelium zu verkünden. Heute braucht die Menschheit, die durch so viel Ungerechtigkeit, Spaltung und Krieg verwundet ist, mehr denn je die Frohe Botschaft des Friedens und der Erlösung in Christus.
Heilige Maria, die du mit uns unterwegs bist, Mutter der missionarischen Jünger Christi und Königin der Missionen, bitte für uns!
Der vollständige Text kann unter www.missio.ch/wms
heruntergeladen werden.
Die Kollekte am Sonntag der Weltmission, am 23. Oktober 2022 ist die grösste Solidaritätsaktion der Katholikinnen und Katholiken weltweit. Mehr als 120 nationale Missio-Stellen auf allen Kontinenten sammeln an diesem Sonntag für die pastorale und diakonische Arbeit in über 1 100 Diözesen. Gläubige weltweit setzen damit ein Zeichen der Hoffnung für die Ärmsten und Bedürftigsten in Lateinamerika, Afrika, Asien und Ozeanien, die sonst vergessen gehen.
Selbstverständlich sind wir bei jeder Messe mit der weltweiten Kirche verbunden. Es lohnt sich jedoch, den Sonntag der Weltmission, der am 22. Oktober 2023 gefeiert wird, zu nutzen, um bewusst eine Gemeinschaft mit Gläubigen aus anderen Ländern und Kulturen zu bilden.
Die Kollekte an diesem Sonntag ist eine aussergewöhnliche Solidaritätsaktion.

Das Prinzip der Kollekte
Die Gütergemeinschaft, wie sie die Urkirche nach der Apostelgeschichte (Apg 4,32ff) praktizierte, ist ein anspruchsvolles Ideal, von dem wir noch weit entfernt sind. Am Sonntag der Weltmission möchten wir einen mutigen Schritt in diese Richtung machen. An diesem Tag ist die Kollekte in allen Pfarreien und Gemeinschaften weltweit für den Solidaritätsfonds der Weltkirche bestimmt. Aus diesem Fonds erhalten finanziell noch nicht selbstständige Ortskirchen entsprechend ihren Bedürfnissen einen Grundbeitrag für ihre Arbeit. In der Schweiz werden die Einnahmen von Missio gesammelt, die das Gesamtergebnis dem Generalsekretariat in Rom mitteilt. Alle anderen Länder tun dasselbe.
Jede nationale Missio-Direktion erhält aus Rom eine Liste von Projekten aus bedürftigen Ortskirchen. Die Generalversammlung der Missio-Direktoren bewilligt die Begründetheit dieser Projekte. Anhand des in Rom mitgeteilten Ergebnisses werden dann Missio Schweiz einige Projekte zugeteilt, darunter auch Projekte aus der Gastkirche Ecuador.
Das Geld wird an die Vertretungen des Heiligen Stuhls in den betreffenden Ländern überwiesen. Die Ortskirchen müssen dann in Form eines Berichts Rechenschaft über die Verwendung der Gelder ablegen. Der Sonntag der Weltmission ist also nicht nur eine Erinnerung an unseren Auftrag als Kirche, sondern auch eine aussergewöhnliche Solidaritätsaktion.
Paulus riet den Christen in Korinth: «Am ersten Tag der Woche lege jeder von euch das, was er sparen kann, zu Hause beiseite, damit man nicht wartet, bis ich komme, um die Gaben einzusammeln»
(1 Kor 16, 2). In gewisser Weise organisierte er damit die erste Kollekte, die für die Weltkirche bestimmt war. In diesem Fall ging es um die Unterstützung der Gläubigen in Jerusalem, aber diese Solidaritätsaktion ging über die materielle Hilfe hinaus: Sie war Teil der Verkündigung des Evangeliums und machte die Gemeinschaft deutlich, die Paulus schaffen wollte (siehe Röm 15, 26). – Foto: missio