Humor und Kirche (Foto: © Peter_Bast_pixelio.de)
Als ich kürzlich jemandem erzählte, dass ich einen Artikel über den Humor in der Kirche schreiben soll, antwortete mir diese Person: «Das wird dann aber ein abnormal kurzer Artikel!»
Tatsächlich scheint es schwierig zu sein, unsere Kirche, unseren Glauben und den Humor unter einen Hut zu bringen. Lachen hat in der Kirche nichts verloren, so sagen manche, denn dort geht es um Kreuz, Leid und Tod, also um die letzten Dinge. Das stimmt! Aber können wir all diese letzten, sicher oft auch schmerzhaften Dinge bestehen, wenn wir uns nicht auch um die vorletzten Dinge kümmern? Kann ein richtig verstandener Humor uns nicht helfen, unser Leben christlicher zu gestalten? Bedeutet «Evangelium» nicht in seinem ursprünglichen Sinn «Frohe Botschaft»? Vielleicht haben wir das in letzter Zeit zu oft vergessen! Es ist wahr: vieles in Kirche und Welt ist nicht zum Lachen und manchen Menschen ist das Lachen und der Frohsinn vergangen. Vieles im Leben und auch in der Kirche ist eher zum Weinen, und die Frohe Botschaft ist oft sehr bedrohlich verkündigt worden. Sie hat nicht dem Leben zum Durchbruch verholfen, sondern hat Ängste geweckt, die selbst vor Gott nicht Halt gemacht haben. «Ich habe in der Kirche gelacht, geschwatzt, herumgeschaut», ist noch in alten Beichtspiegeln zu lesen.
Hat Gott eigentlich Humor?
Eine Volksweisheit sagt, dass Gott durch die Schaffung des Menschen selbst Humor bewiesen hat. Nicht alle sehen dies aber so. Erinnern Sie sich noch an den Film «Der Name der Rose», in dem William von Baskerville (dargestellt von Sean Connery) die Hauptrolle spielt. Darin treffen wir auf den alten Mönch Jorge de Burgos. Er ist ein Fanatiker, für den es nur die eine göttliche Wahrheit gibt. Sie zu verteidigen, ist jedes Mittel – Mord eingeschlossen – recht. Dieser blinde Bibliothekar ist auch der Hüter des Buches «Die Komödie» des griechischen Philosophen Aristoteles. Man weiss, dass es dieses Buch gibt. Aber niemand kennt es, Jorge hat das Buch vergiftet, um zu verhindern, dass es bekannt wird, denn durch die Beschreibung der Komödie «adelt» Aristoteles das Lachen. Jorge ist dies ein Dorn im Auge, denn seiner Meinung nach nimmt das Lachen den Menschen die Angst vor der Autorität, vor allem vor Gott. Und Menschen, die keine Angst vor der Autorität mehr haben, unterwerfen sich dieser Autorität nicht mehr bedingungslos. Eine Autorität, über die man lachen darf, ist keine absolute Autorität mehr und auch ein Gott, über den gelacht werden darf, ist kein Gott mehr. Jesus habe weder Komödien noch Fabeln erzählt, sondern klare Gleichnisse, die uns bildhaft lehren, wie wir ins Paradies gelangen, und so solle es bleiben. Jorges Fanatismus führt den Mönch so weit, dass er, als ihm der pfiffige William auf die Spur kommt, die Bibliothek in Brand steckt. Im Gegensatz dazu ist für William von Baskerville ein lachender Mensch ein freier Mensch, der nicht alles naiv glaubt und angemasste Autoritäten kritisch hinterfragt.
Was hier filmisch dargestellt wird, war im Mittelalter kein Witz. Vielmehr galt bis ins 11. Jahrhundert hinein in den Klöstern strengstes Lachverbot. Denn schliesslich sei auch Jesus immer ernst gewesen und jeder müsse ihm darin nacheifern.

Foto: ©Rike_pixelio.de
Hat Jesus gelacht?
Wer im Neuen Testament nach Aussagen sucht, die zeigen, dass Jesus gelacht hat, wird nichts finden. Nirgends steht geschrieben, Jesus wäre humorvoll gewesen oder er hätte gar hie und da einen Witz erzählt, um seine Jünger bei Laune zu halten. Hatte Jorge de Burgos mit seiner Einstellung also Recht?
Wir sehen in der Heiligen Schrift, dass Jesus gerne an Festen teilgenommen hat und sich auch immer wieder zu Essen einladen liess. Wir können davon ausgehen, dass Jesus nicht mit einer ernsten Leichenbittermiene nur dort gesessen und das Essen in sich hineingestopft hat. Es ist wohl kaum ein Zufall, dass das erste Wunder, das Jesus gewirkt hat und der Evangelist Johannes überliefert, nicht etwa eine Krankenheilung oder die Auferweckung eines Toten war, sondern eine Weinvermehrung bei einer Hochzeit in Kana. Und wie wir dem Text entnehmen können, war es nicht gerade eine kleine Menge Wein: 600 Liter! Eingedenk dessen, dass die Festgemeinde bereits schon die gleiche Menge getrunken hatte, kann man sich vorstellen, wie dort «die Party abging», eine Party, die damals mehrere Tage dauerte. Jesus war kein Kind von Traurigkeit! Im Gegenteil! Die Pharisäer und Schriftgelehrten bezeichneten ihn sogar als «Fresser und Säufer» (Mt 11, 18). Scheinbar konnten es manche «Frommen» jener Zeit nicht ertragen, dass Jesus auch die angenehmen Seiten des Lebens zu geniessen verstand, mit Freunden zusammensass, ein gutes Essen und guten Wein zu schätzen wusste. Ein solches Verhalten passte nach Ansicht vieler Leute nicht zu einem frommen Mann, der von Gott und seinem kommenden Reich sprach.
Der heilige Clemens von Alexandria hat zu Beginn des dritten Jahrhunderts mit dem Buch «Paidagogos» den ersten christlichen Lebensratgeber geschrieben. Darin grenzt er sich von einer Gruppe besonders frommer, leib- und weltfeindlicher Christen ab, die in der Oberschicht von Alexandria die Verachtung aller schönen Dinge propagierten. Im Blick auf die Hochzeit von Kana schreibt er, dass radikales Christsein befreites Leben sei. Der Mensch gewordene Jesus habe nicht nur unser Leiden auf sich genommen, sondern auch das Fleisch befreit. Wir dürften also in Ruhe altern, Falten und graue Haare kriegen, da wir ja unsere endgültige Erfüllung nicht im Diesseits suchen müssten; die würde uns in der Ewigkeit zuteil. Ist das nicht ein Grund zur Freude?
Jesus geht es um das Heil und das Glück des Menschen, gerade des an den Rand der Gesellschaft gedrängten, die ihm immer besonders nahestanden. Die Theologin Claudia Nieser hat wohl Recht, wenn sie schreibt, dass es den Religionen letztlich um das Glück des Menschen gehe. «Sie wollen seinem Leben einen höheren Sinn geben, wollen ihn befreien von der Last, in die kurze Zeit seines Lebens so viel wie möglich hineinpacken zu müssen: so viel Erlebnis wie möglich, so viel Erfolg wie möglich, so viel Selbstverwirklichung wie möglich.» Nicht auf Kosten des Anderen, aber als Voraussetzung zu einem Leben, das auch den Armen und Bedürftigen als Bruder und Schwester annimmt und ihm/ihr zu helfen versucht, oder wie es Bischof Franz Kamphaus gesagt hat: «Wer sich selbst nicht riechen kann, stinkt auch den anderen!»
Heilige Frohnaturen
Im Laufe der Geschichte hat es Heilige gegeben, die den Glauben als Frohe Botschaft verstanden haben und dadurch ihre Umgebung mit Frohsinn und Humor heller gemacht haben.

Das Leben des italienischen Jugendseelsorgers, des heiligen Don Giovanni Bosco (1815–1888) lautete: «Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen». Als Erzieher und Priester versuchte Don Bosco, seinen Jugendlichen Hoffnung aus dem christlichen Glauben zu vermitteln und ihnen durch Wort und Tat das «Evangelium», die Frohbotschaft, zu bezeugen. Als Seelsorger wusste er: Wer sich in der «guten Nachricht» von Jesus, dem Lebensbringer, verwurzelt, der gewinnt auch den Mut und die Stärke, die Aufgaben des Lebens zu bewältigen.

Oder denken wir an den heiligen Philipp Neri (1515–1595), der mehr als 500 Jahre nach seiner Geburt nicht zuletzt wegen sei–nes geistreichen Humors immer noch zu den beliebtesten Heiligen zählt. Den gebürtigen Florentiner zeichnete neben Intellektualität und Demut auch Heiterkeit und Liebenswürdigkeit aus, «die er als Mittel zur geistlichen Führung einsetzte» und damit «Menschen bis heute an sich ziehen und für Gott gewinnen» kann. Über seinen Humor wurden ganze Bücher geschrieben.

Thomas Morus (1478–1535) war Lordkanzler von König Hinrich VIII. in England. Als sich dieser von der katholischen Kirche lossagte, um seine dritte Frau heiraten zu können und von seinen Untertanen verlangte, dass auch sie den Suprematseid leisten und damit den König als weltliches und geistliches Oberhaupt anerkennen müssen, lehnte Thomas Morus diesen Eid ab. Er wurde deshalb als Landesverräter im Tower von London hingerichtet. Von ihm ist ein Gebet um Humor bekannt:
«Schenke mir eine gute Verdauung, Herr,
Und auch etwas zum Verdauen.
Schenke mir Gesundheit des Leibes
mit dem nötigen Sinn dafür,
ihn möglichst gut zu erhalten.
Schenke mir eine heilige Seele, Herr,
die im Auge behält, was gut und rein ist,
damit sie sich nicht einschüchtern lässt
vom Bösen, sondern Mittel findet,
die Dinge in Ordnung zu bringen.
Schenke mir eine Seele,
der die Langeweile fremd ist,
die kein Murren kennt
und kein Seufzen und Klagen,
und lasse nicht zu,
dass ich mir allzuviel Sorgen mache
um dieses sich breit machende Etwas,
das sich „Ich“ nennt.
Herr, schenke mir Sinn für Humor.
Gib mir die Gnade,
einen Scherz zu verstehen,
damit ich ein wenig Glück kenne im Leben
und anderen davon mitteile.»
In der Nachfolge Jesu haben diese Heiligen und noch viele weitere vor und nach ihnen, den Humor eingesetzt, um die Frohe Botschaft den Menschen nahezubringen. Es geht nicht um das Lächerlichmachen von heiligen Dingen und Personen, aber: «Wir müssen unseren Gott nicht mit zusammengezogenen Augenbrauen loben, wir müssen es nicht mit phantasieloser Korrektheit tun. Wir können es mit Heiterkeit, Humor und Freude tun, denn es gilt das grosse Wort des Kirchenvaters Irenäus von Lyon (135–202): “Die Freude Gottes ist der lebendige Mensch.” Und nirgends sind wir mehr Mensch, nirgends sind wir unserem Wesen näher, als wenn wir uns an seiner Liebe und Gegenwart freuen.» Paul Martone
Fotos Don Bosco: Agenzia Info Salesiana. Philippe Neri, Thomas Morus: oekumenisches heiligenlexikon.de




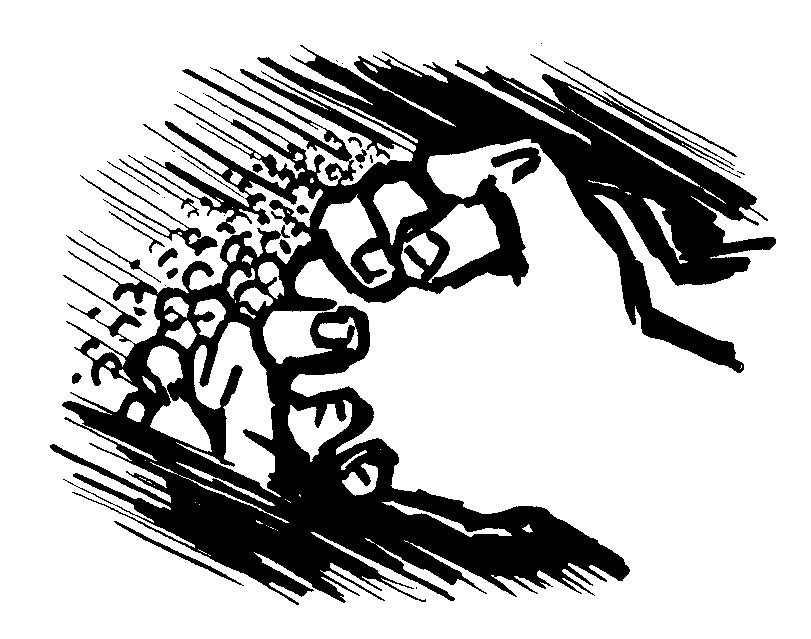
 «Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet! Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet» (Matthäus, 7, 7–8)
«Bittet und es wird euch gegeben; sucht und ihr werdet finden; klopft an und es wird euch geöffnet! Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet» (Matthäus, 7, 7–8)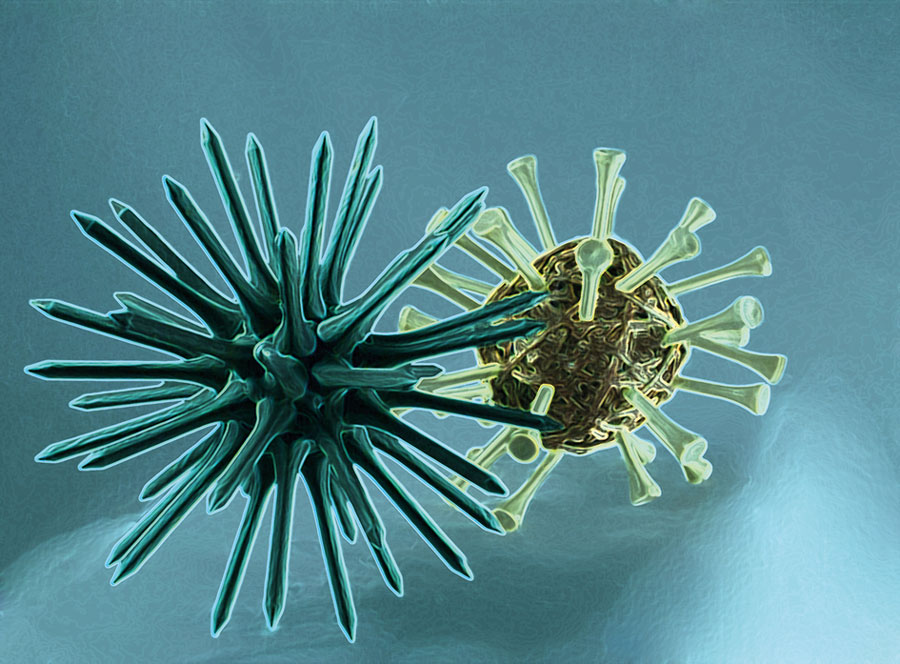
 Zurzeit wird sehr viel über das Corona-Virus gesprochen. Manche Leute behaupten, dass es sich dabei um eine Strafe Gottes handle. Was sagen Sie dazu?
Zurzeit wird sehr viel über das Corona-Virus gesprochen. Manche Leute behaupten, dass es sich dabei um eine Strafe Gottes handle. Was sagen Sie dazu?














 Wenn Papst Franziskus die bevorzugte Option der katholischen Kirche zugunsten der Armen bekräftigt (siehe Evangelii gaudium, Nr. 186–216), dann deshalb, weil es sich dabei vor allem um einen biblischen und theologischen Begriff handelt und nicht um einen gesellschaftspolitischen. Im Alten Testament bilden die «Armen des Herrn» eine Kategorie unter den Menschen, die die Verheissungen des Bundes tragen, weil sie für das Handeln Gottes verfügbar sind: «Sucht den Herrn, all ihr Gedemütigten im Land, die ihr nach dem Recht des Herrn lebt! Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut! Vielleicht bleibt ihr geborgen am Tag des Zorns des Herrn». (Zephanja 2, 3)
Wenn Papst Franziskus die bevorzugte Option der katholischen Kirche zugunsten der Armen bekräftigt (siehe Evangelii gaudium, Nr. 186–216), dann deshalb, weil es sich dabei vor allem um einen biblischen und theologischen Begriff handelt und nicht um einen gesellschaftspolitischen. Im Alten Testament bilden die «Armen des Herrn» eine Kategorie unter den Menschen, die die Verheissungen des Bundes tragen, weil sie für das Handeln Gottes verfügbar sind: «Sucht den Herrn, all ihr Gedemütigten im Land, die ihr nach dem Recht des Herrn lebt! Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut! Vielleicht bleibt ihr geborgen am Tag des Zorns des Herrn». (Zephanja 2, 3)










